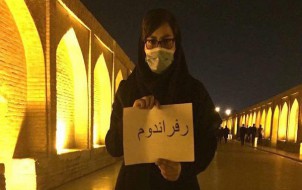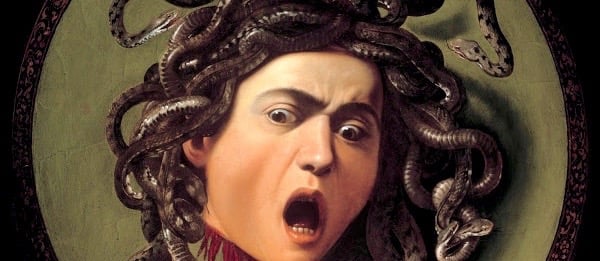Der Österreicher Robert Menasse, 1954 geboren, hat sich als Essayist schon öfters mit dem Problemkreis Europa beschäftigt. In seinem 2017 mit dem deutschen Bruchpreis ausgezeichneten Roman „Die Hauptstadt“ setzt er sich nun weniger als kritischer Kommentator mit der Institution Europäische Union auseinander, dafür als scharf beobachtender, pointierter Romancier mit den Menschen, die in der EU-Zentrale in Brüssel zu Gange sind. Dort fördert er einiges an bürokratischem Wahn- und Irrsinn zutage und findet eher wenig Frohsinniges.
Herrenloses Schwein in Brüssel
So beginnt „Die Hauptstadt“: „Da läuft ein Schwein! David de Vriend sah es, als er ein Fenster des Wohnzimmers öffnete, um noch ein letztes Mal den Blick über den Platz schweifen zu lassen, bevor er diese Wohnung für immer verliess. Er war kein sentimentaler Mensch. Er hatte sechzig Jahre hier gewohnt, sechzig Jahre lang auf diesen Platz geschaut, und jetzt schloss er damit ab. Das war alles. Das war sein Lieblingssatz – wann immer er etwas erzählen, berichten, bezeugen sollte, sagte er zwei oder drei Sätze und dann: ‚Das war alles.‘ Dieser Satz war für ihn die einzig legitime Zusammenfassung von jedem Moment oder Abschnitt seines Lebens.
Die Umzugsfirma hatte die paar Habseligkeiten abgeholt, die er an die neue Adresse mitnahm. Habseligkeiten – ein merkwürdiges Wort, das aber keine Wirkung auf ihn hatte. Dann sind die Männer von der Entrümpelungsfirma gekommen, um alles Übrige wegzuschaffen, nicht nur was nicht niet- und nagelfest war, sondern auch die Nieten und Nägel, sie rissen heraus, zerlegten, transportierten ab, bis die Wohnung ‚besenrein‘ war, wie man das nannte. De Vriend hatte sich einen Kaffee gemacht, solange der Herd noch da war und seine Espressomaschine da stand, den Männern zugeschaut, darauf achtend, ihnen nicht im Weg zu stehen, noch lange hatte er die leere Kaffeetasse in der Hand gehalten, sie schliesslich in einen Müllsack fallen lassen. Dann waren die Männer fort, die Wohnung leer. Besenrein. Das war alles.“
Im Dienst seiner Figuren
Was ist das für ein Schwein, das in Brüssel umherstreift und die Gerüchteküche befeuert? Und wer ist der greise Herr, David de Vriend, der als erste Figur eingeführt wird? Diese Fragen werden im Verlauf des Romans in der eleganten, stilvollen Manier verhandelt, die dem Begriff Polyphonie gerecht wird: Robert Menasse stellt sich ganz in den Dienst seiner Figuren, die so von einem besonderen Zauber umflort werden, an Plausibilität gewinnen.
David de Vriends Persönlichkeit erhält anrührende Konturen, indem der Autor ihre beispiellose Vita nach und nach aufblättert, mit Lakonie und dem gebotenen Respekt: Sie wurzelt im düstersten Kapitel der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, im Nationalsozialismus des Hitler-Regimes, im Dritten Reich.
Das „Jubilee Project“
In „Die Hauptstadt“ geht es um ein bevorstehendes Jubiläum der EU-Kommission. Die Grösse des Ereignisses soll mit einem PR-wirksamen „Jubilee Project“ gefeiert werden, was so einfach nicht ist. Die Renommier-Departemente der EU wie etwa die Wirtschaftsabteilung halten sich bedeckt, weil sich die finanzstarken, tonangebenden Mitgliedstaaten aus Prestigegründen lieber selber darstellen, als im Verbund mit anderen die zweite Geige zu spielen. Darum beauftragt die EU-Chefetage, so diplomatisch wie berechnend, die Kulturabteilung mit der Projektentwicklung. Sie wird von Fenia Xenopoulou geführt, deren griechisch-zypriotische Herkunft sie – quotenbedingt – überhaupt erst in die direktoriale Position befördert hat; was im Buch dann noch eine Rolle spielen wird!
Frau Xenopoulou ist um die vierzig, ambitioniert und sich sehr wohl bewusst, dass die Kulturabteilung in der EU-Hierarchie nicht in der Champions-League agiert. Robert Menasse: „Die Kultur war ein bedeutungsloses Ressort, ohne Budget, ohne Gewicht in der Kommission, ohne Einfluss und Macht. Kollegen nannten die Kultur ein Alibi-Ressort – wenn es das wenigstens wäre! Ein Alibi ist wichtig, jede Tat braucht ein Alibi! Aber die Kultur war nicht einmal Augenwischerei, weil es kein Auge gab, das hinschaute, was die Kultur machte.“ (…) „Wenn der Kommissar für Handel oder für Energie, ja sogar wenn die Kommissarin für Fischfang während einer Sitzung der Kommission auf die Toilette musste, wurde die Diskussion unterbrochen und gewartet, bis er oder sie zurückkam. Aber wenn die Kultur-Kommissarin rausmusste, wurde unbeeindruckt weiterverhandelt, ja es fiel gar nicht auf, ob sie am Verhandlungstisch oder auf der Toilette sass. Fenia Xenopoulou war in einen Aufzug gestiegen, der zwar hochgefahren, aber dann unbemerkt zwischen zwei Stockwerken stecken geblieben war.“
Wahrheit und Dichtung
Wer im Karrieristen-„Leiterlispiel“ dennoch weiterkommen will, muss sich etwas einfallen lassen. Madame bittet ihre Mitarbeitenden zum Brainstorming, mit bescheidenem Ergebnis. Doch ihr Referent Martin Susman – Sohn eines österreichischen Schweinebauern und Bruder eines Lobbyisten, der einen EU-Deal mit dem potenten Schweinefleisch-Abnehmer China einfädeln will – hat eine aufsehenerregende Idee. Nach einer Dienstreise zur polnischen Holocaust-Gedenkstätte Auschwitz schlägt er vor, die allerletzten Zeitzeugen des Genozids in den Mittelpunkt des „Jubilee Projects“ zu stellen. Susman ist überzeugt, dass ein Hauptanliegen der EU – die Überwindung des nationalstaatlichen Grössenwahns mit seinem pervertierten Machtstreben, der Kriegstreiberei, dem Rassismus und der sozialen Ungleichheit – im Grunde erst nach der Zerschlagung der Hitlerei 1945 hatte Gestalt annehmen können.
Susmans Vorschlag scheint historisch und ethisch untadelig zu sein. Auffällig schnell wird er von oben mit Applaus bedacht und zur Weiterbearbeitung freigegeben. Doch kaum geht es ans Umsetzen, rumpelt es in der EU-Kommission: Das Trauma von Auschwitz im Fokus einer Geburtstagsfeier? Wer könnte, wer will sich damit profilieren? Und auf wessen Kosten? Und, praktisch gesehen, wie liessen sich die über den Globus verstreuten Opfer auffinden, wer kennt ihre Namen, ihre Anschrift? Und, nicht zuletzt: Wo sollte der Anlass stattfinden? In Brüssel, gar in Auschwitz selber?
Robert Menasse erzählt eine fiktive Geschichte, wobei einem flugs dämmert, dass sein Text mehr Wahrheit als Erfundenes enthält. Weil der Autor, der jahrelang recherchiert hat, nun in die neuere europäische Geschichte sowie in die Machtrangeleien im bürokratischen Konstrukt EU hineinleuchtet. Und einem auch bewusst macht, dass sich in Belgiens Metropole ebenfalls das neue „NATO HQ“ (neues Nato-Hauptquartier) befindet, wo konfliktentscheidende militärische Entscheide gefällt werden.
Robert Musil im Subtext
Im Subtext von „Die Hauptstadt“ erinnert Menasse auch an Robert Musils monumentalen Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ (1943). Dieser soll, so wird kolportiert, das Lieblingsbuch des Präsidenten der EU sein. Der taucht als Person im Roman zwar nicht auf, schwebt jedoch über allem. Und somit ist klar, dass wer in der EU vorankommen will, mit Musils Hauptwerk vertraut sein sollte.
Dass Menasse auf „Der Mann ohne Eigenschaften“ verweist, ist nachvollziehbar. Musil beschreibt dort am Beispiel der Österreichisch-Ungarischen Monarchie rückschauend die Veränderung der Ordnung und Struktur in Europa anfangs des 20. Jahrhunderts. So wie es Robert Menasse heute als beobachtender Zeitgenosse in Sachen EU tut. Schriftsteller brauchen sich nicht hinter Reglementen, Verordnungen, Verträgen zu verschanzen, sie dürfen, sie sollen, sie müssen die Gedanken frei schweifen lassen, bis ins Visionäre, bis ins Unmöglich scheinende hinan.
In diesem Sinn ist „Die Hauptstadt“, bei allen Quellen-Verweisen, vor allem eine faszinierende Melange aus Gesellschaftsroman, Politsatire, Lovestory und einem Hauch von Thriller; ein moderner Roman zur Zeit, der die künstlerische Freiheit ausreizt, ohne sie über Gebühr zu strapazieren.
Tauchfahrt ins Labyrinth der EU
Im Buch geht es wie erwähnt auch um Schweine – im wortwörtlichen wie im übertragenen Sinne. Deren Bedeutung erschliesst sich aus dramaturgisch geschickt angelegten metaphorischen Hinweisen. Eines streunt also herrenlos in Brüssel umher, behindert den Verkehr, taucht in den Medien auf und wird sogar auf einem Soldaten-Friedhof verhaltensauffällig. „Schwein“ steht für alle Varianten des Begriffs, vom Glücksschwein bis zur Drecksau, vom Sparschwein bis zum kinderfreundlichen Schweinchen Schlau und auch für Sauereien aller Art. Dass der eine oder die andere im Roman mehr Schwein hat als Verstand ist gegeben. Und wie sagte Menasse in einem Interview? „Ein Schwein läuft durch Brüssel, Europa wird wie ein Schwein durchs Dorf getrieben.“
„Die Hauptstadt“ ist eine Art Tauchfahrt ins babylonische Labyrinth der EU, wo Funktionäre, Delegierte und Lobbyisten jeglicher Couleur herumwuseln. Menasses Blicke – ohne Häme, ohne Besserwisserei – in die Kulissen, die Orchestergräben der Brüsseler Europa-Oper mit ihren Baustellen wie verschuldeten Mitgliederstaaten, der Flüchtlingskrise, dem Brexit, sind auf hohem Niveau unterhaltsam.
Der Solitär und die Salamander
Menasse holt Menschen mit Eigenschaften auf die Bühne. Die besagte Fenia Xenopoulou mit ihrem verkorksten Gefühlsleben. Einige namenlose „Salamander“ genannte Streber, wie man ihnen in vielen Berufen begegnet und die Menasse so skizziert: „… man kann sie ins Feuer werfen, aber sie verbrennen nicht, ihr Hauptmerkmal ist ihre Unzerstörbarkeit.“ Ja, dieser Autor weiss, wie man Personen und Schauplätze beschreibt. Und er hat ein stupendes Flair für das Auslegen von Handlungssträngen, die er dann nicht auf Teufel komm raus zusammenführen will, ab und an sogar ins Leere laufen lässt, ohne dass das einen stört. Wie dort, wo ein überforderter Polizeikommissar, der in einem Auftragsmord ermittelt, erleben muss, wie seine Arbeit von obskuren Mächten torpediert wird.
Tiefgründiger legt Menasse die Figur eines Wiener Historikers namens Alois Erhart an. Der Professor gehört dem EU-Think-Tank „New Pact for Europe“ an und soll in Brüssel ein Referat halten; es ist von derart bissiger Qualität und Leidenschaft, dass den von wenig geschichtlichem Bewusstsein gestreiften Konferenz-Teilnehmern Hören und Sehen vergeht. Wenn sich so die intellektuelle, realpolitische Seite der EU-Medaille manifestiert, dann steht David de Vriend für das, was die EU ideell im zutiefst Mitmenschlichen ausmachen könnte. Und er wäre – von einem unsagbaren Lebensschicksal geprägt – exakt der Solitär gewesen, den sich der EU-Kulturreferent Martin Susman als Mahner für sein „Jubilee Project“ vorgestellt hat.
Die Würde des Menschen
Just wenn einem die Vielfalt der Geschehnisse fast schon etwas zu überfordern droht, steuert Robert Menasse narrativ zügig auf einen Showdown im Herzen Brüssels zu. Da wird einem nochmals drastisch bewusst, dass seine Fiktion stärker von der Wirklichkeit überlagert ist, als einem lieb sein kann. Legt man danach das Buch aus der Hand, erinnert man sich an den eingangs erwähnten Text über David de Vriend: „Er war kein sentimentaler Mensch. Er hatte sechzig Jahre hier gewohnt, sechzig Jahre lang auf diesen Platz geschaut, und jetzt schloss er damit ab. Das war alles. Das war sein Lieblingssatz – wann immer er etwas erzählen, berichten, bezeugen sollte, sagte er zwei oder drei Sätze und dann: ‚Das war alles.‘ Dieser Satz war für ihn die einzig legitime Zusammenfassung von jedem Moment oder Abschnitt seines Lebens.“ Ohne pathetische Überhöhung verleiht der Autor seiner Leitfigur de Vriend eine charismatische Aura, versinnbildlicht in ihr das, was unantastbar ist, aber immer wieder mit Füssen getreten wird: die Würde des Menschen.
Robert Menasse, der übrigens von sich sagt, er sei ein Sensibelchen mit Hang zur Schwermut, lässt uns tief ins Herz der Finsternis blicken. Aber er entlässt uns nicht zu Tode betrübt. Weil es ihm in seinem beherzten Werk gelingt, das Quäntchen Hoffnung machender Neugierde zum Glimmen zu bringen, das sich bereits in einer Kapitelanmerkungen ankündigt: „Zusammenhänge müssen nicht wirklich bestehen, aber ohne sie würde alles zerfallen.“
 Robert Menasse: Die Hauptstadt. Suhrkamp, Berlin 2017, 459 Seiten. Auch als Hörbuch sehr empfehlenswert (Vorleser: Christian Berkel).
Robert Menasse: Die Hauptstadt. Suhrkamp, Berlin 2017, 459 Seiten. Auch als Hörbuch sehr empfehlenswert (Vorleser: Christian Berkel).

 Peter K. Wehrli, «O quadrado e os cinco temas», Verlag Ciedima, Maputo, Moçambique
Peter K. Wehrli, «O quadrado e os cinco temas», Verlag Ciedima, Maputo, Moçambique