Wir leben in einem Zeitalter, in welchem alles moralisch motiviert werden muss.
Hugo Loetscher, geboren heute vor 90 Jahren
Indien erwacht
‘August Kranti Marg’, der ‘Platz der August-Revolution’ in Mumbai, bezieht seinen Namen aus einem Treffen der Kongresspartei am 8.August 1942. Es gipfelte im Aufruf Mahatma Gandhis, den immer noch gewaltlosen Kampf gegen das Kolonialjoch kompromisslos zu Ende zu führen. ‘do or die!’ lautete der Appell an seine Mitbürger, ‘Quit India!’ war die Aufforderung an die britische Weltmacht.
Am letzten Donnerstag tauchte der ‘Quit India’-Slogan öfter in Transparenten auf, hoch über den vielen tausend Menschen, die Kopf an Kopf im August Kranti Marg standen. Allerdings war es ein anderer Gegner, der nun zum Verlassen des Landes aufgefordert wurde: “Modi/ Shah – Quit India!”. Der Spruch kam auch als Staccato-Refrain aus den Kehlen der (gemäss Polizei) rund 20’000 Teilnehmern, bevor aus einer anderen Richtung ein neuer Slogan laut wurde.
Der häufigste lautete ‘Azadi’ – Freiheit. Auch dieser Ruf stammt aus der Unabhängigkeitsbewegung, und wie ‘Quit India!’ gewann er in den landesweiten Protesten der letzten Tage eine zusätzliche Bedeutung. Nicht nur erinnerte er an die Ideale der Unabhängigkeitsbewegung, als sich die grosse Mehrheit der Inder als Teil einer Nation fühlte. Er sollte auch klarstellen, dass ‘Freiheit’ eine der Errungenschaften dieses Kampfs ist, die sich die jungen Inder nicht nehmen lassen wollen.
‘Ich bin ein Hindu, aber kein (Sau)hund’
Das zeigten auch die Sprüche auf den anderen Plakaten. Einer begann mit ‘2014 – Make in India’, bezugnehmend auf die Modi-Initiative für mehr Industrieproduktion, um dann fortzufahren: ‘2019 - Breaking India’. Ein Plakat sagte schlicht ‘Ich bin ein Hindu, aber kein (Sau)hund’. Ein weiteres war ohne Worte: Es zeigte eine Hitlerfigur, die ein strampelndes Baby hochhält, das dem Premierminister verblüffend ähnlich sieht.
Wie immer bei Protestdemonstrationen, war auch jene im Zentrum der Altstadt eine paradoxe Mischung von Bitterkeit, Zorn – und Fröhlichkeit. Die allermeisten Teilnehmer waren um die Zwanzig (meine Frau und ich waren – einigermassen konsterniert - weitherum die ältesten). Wie die vielen Tausend, die nun jeden Tag in zahlreichen Städten Indiens auf die Strassen gehen, war es auch in Mumbai für die Meisten das erste Mal, dass sie politisch aktiv wurden.
Ihr Zorn ist wohlbegründet, sehen sie doch, wie eine für sie sinnlose religiöse Identitätspolitik das Land zu spalten droht, die Aussicht auf eine Karriere gefährdet, und eine ganze Generation einem Überwachungsstaat ausliefern will.
Menschenrechte, Demokratie, Föderalismus, Religionsfreiheit
Aber eine öffentliche Kundgebung gibt ihnen, wohl zum ersten Mal, eine ermutigende Einsicht: Wir sind dieser Gefahr nicht allein ausgesetzt, solidarische Bürger können dem Staat die Stirne bieten. So war es denn auch verständlich, dass sich zornig skandierte Slogans abwechselten mit lachendem Klatschen, Reihen im Schulterschluss unterbrochen wurden durch kleine Kreise, die ihre Protestslogans sangen und tanzten.
Der englische (nicht französische!) Begriff Participation Mystique kam in den Sinn, dieses riskante Aufgehen von individueller Identität in eine Gruppen-Emotion. Sie erlebte ihren intensivsten Moment, als die Menge feierlich, Wort für Wort, die Präambel der Verfassung nachsprach, die ihnen eine Rednerin vorlas. Es war wie eine Erneuerung des Eids auf die Grundätze, die ihnen die Verfassungsväter vorgegeben hatten: Menschenrechte, Demokratie, Föderalismus, Religionsfreiheit.
Es war auch der Augenblick, an dem die rund 2000 aufgebotenen Polizeibeamten ihre Bambusstöcke senken konnten, mit denen sie zuvor nervös hantiert hatten. Im Gegensatz zu anderen Städten, namentlich im Norden des Landes, verlief der Protesttag im (wie ein Teilnehmer ulkte) „December Kranti-Park“ friedlich.
Polizisten verprügeln Studenten
Wie stark demokratische Grundrechte gefährdet sind, zeigte das Verhalten der Polizei vergangene Woche in den von der Regierungspartei kontrollierten Bundesstaaten (das Polizeiwesen fällt in die Kompetenz der Provinz). Dort wurde ein drakonischer Kolonialparagraph im Strafgesetz bemüht – Paragraph 144 –, der jede öffentliche Ansammlung von über sechs Personen mit Haft bestraft.
In Bangalore wurde der Historiker und Gandhi-Biograf Ram Guha verhaftet, als er an einer friedlichen Kundgebung teilnahm. Journalisten wurden mit Schlagstöcken traktiert, insbesondere, wenn ihre Pressekarte einen Muslim als Träger auswies.
In Delhi drang die Polizei in den Campus der Jamia Millia-Universität – eine von Muslimen gegründete Lehrstätte – ein. Beamte zerschmetterten Büchervitrinen der Bibliothek, und leerten in Studentinnen-Schlafsälen den Schrankinhalt. Sie schlugen auf unbeteiligte Studenten ein und zwangen sie, mit erhobenen Armen und in Einer-Kolonne in wartende Polizeibusse zu steigen. (Die Delhi-Polizei untersteht dem Zentralstaat).
Kaltgestelltes Internet
Ein Dutzend Stationen der U-Bahn – inzwischen die wichtigste Verkehrsader der Hauptstadt – wurde ohne Warnung geschlossen, um den Zustrom von Demonstranten und Sympathisanten zu stoppen. Noch drastischer war das Abwürgen des digitalen Verkehrs. In zahlreichen Städten wurde das Internet ebenfalls ohne Ankündigung kaltgestellt.
Gerade im Bereich der digitalen Demokratie zeigt sich, dass das neue Indien unter Modi ihre vielgepriesene IT-Kompetenz (‘The techno-savvy PM’) à la chinoise umsetzt. Eine neue Studie des amerikanischen Software Freedom Law Centre (SFLC) zeigt, dass Indien das Land ist, das weitaus am meisten Internet-Sperren verhängt. In den letzten fünf Jahren waren es 16’000 Stunden; der volkswirtschaftliche Verlust wird auf 3 Milliarden Dollars geschätzt. In Kaschmir ist das Internet seit nun 140 Tagen weitgehend abgeschaltet.
Einmal mehr sind es repressive Gesetze aus der Kolonialzeit, die als Rechtsgrundlage dienen; neben dem Strafgesetz-Paragraphen 144 ist es der Telegraph Act von 1885!). Beide rechtfertigten mit ihren Gummi-Paragraphen (‘Wahrung öffentlicher Ruhe’, ‘öffentliche Sicherheit’ ) den kolonialen Polizeiknüppel. Nun werden sie von dessen Opfern gegen die eigenen Mitbürger eingesetzt.
Die grösste Protestwelle seit den Siebzigerjahren
Neu (und ermutigend) ist, dass diese Opfer in der aktuellen Protestbewegung nicht nur Muslime sind, sondern zahlreiche Bürger anderer Konfessionen. Zunächst hielten sich die Islamgläubigen zurück, eingeschüchtert von Lynchjustiz und dem sorgfältig gepflegten ‘Terror’-Etikett. Doch die Bilder von Teilnehmern quer durch alle Schichten, in ihrer Mehrzahl Hindus, hat sie ermutigt, auf die Strasse zu gehen.
Auch die perfide Bemerkung des Premierministers – “Man braucht nur ihre Kleider anzuschauen um zu wissen, wer (hinter den Protesten) steckt” – hält sie nun nicht mehr zurück. Dahinter steckt aber auch die Einsicht, dass Schweigen und ein passives Wahlverhalten ihnen nichts gebracht hat; es hat die Einschüchterungspolitik nur noch ermutigt, und Modi seinen Erdrutschsieg gebracht.
Seit den Siebziger Jahren hat das Land keine Protestwelle von dieser landesweiten Breitenwirkung und Hartnäckigkeit erlebt. Sie hat auch die Oppositionsparteien ermutigt, ihre Kritik an der Modi-Regierung zu verstärken. Alle elf Bundesstaaten, die nicht von der BJP kontrolliert werden, haben erklärt, die landesweite Kontrolle des Bürgerrecht-Status (‘NRC’ – National Registry of Citizenship’) nicht durchführen zu wollen.
Plötzlich schweigt der Innenminister
Nun haben sich auch die regionalen Koalitionspartner Modis gegen diesen ‘Spaltpilz’ ausgesprochen. Es ist ein Zeichen, dass das neue Bürgerrechtsgesetz und die Volksbefragung an den Urnen Folgen haben könnten. Selbst die Regierungspartei versucht inzwischen, den Ton zu dämpfen. Die Partei hat ihren einzigen Muslim im Kabinett an die Front geschickt, um ‘Inklusivität’ zu demonstrieren (M.A.Naqvi ist ein nichtgewähltes Mitglied des ‘Oberhauses’). Er versicherte, der NRC sei “ein ungeborenes Baby”; die ganze “Aufregung” lohne sich nicht.
Innenminister Shah, der die diskriminierende Zielsetzung seiner Migrationspolitik unverfroren ausspricht, hüllt sich plötzlich in Schweigen. Stattdessen tweetete er diese Woche Bilder seiner Teilnahme an einem Treffen zur Feier des 150. Geburtstags von Mahatma Gandhi. Es war die Tageszeitung Indian Express, die ihn darauf aufmerksam machte, dass Indiens Landesvater, wäre er am Leben, statt an einer Feier wahrscheinlich an einem Protestmarsch teilgenommen hätte.
Und sie bewegt sich doch…
Das Schweizer-Haus ist renovationsbedürftig. Viel zu lange bremsten vergangenheits- oder ideologieorientierte verharrende Kräfte politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Doch seit den National- und Ständeratswahlen diesen Herbst hat sich der Wind des Wandels aufgefrischt. Reformresistente Parteien verstehen die Schweiz nicht mehr. Junge Kräfte haben gepunktet – weil sie wählen gingen. Damit verbessern sich die Voraussetzungen für überfällige Reformen des Geschäftsmodells Schweiz. Es ist höchste Zeit.
Kooperation als Voraussetzung
Bevor ein Gebäude mit Eigentumswohnungen renoviert wird, müssen sich alle involvierten Eigentümer über die Massnahmen einig werden. Passiert das nicht, bleiben dringende Sanierungsfälle oft jahrelang blockiert. Die Folge: Grössere Schäden, höhere Kosten. In neueren Verträgen muss sich deshalb nur noch eine einfache Mehrheit der Eigentümer einig werden; die Vorteile sind eminent.
Wenn wir vom Schweizer-Haus reden haben in der Vergangenheit sehr oft die beiden politischen Pole dringende Reformschritte blockiert. Man sprach von „unheiligen Allianzen“. Nach den eidgenössischen Wahlen diesen Herbst hat die „grüne Welle“ Wahlprognosen gleich haufenweise weggespült. Historisch ist der Sprung des Frauenanteils nach oben, rund ein Drittel höher liegt er nun. Besonders junge Frauen sind auf dem Vormarsch und Frauen wird im Allgemeinen mehr Kompromissfreudigkeit zugestanden als Männern. Ob nun deshalb in nächster Zeit konkrete Reformschritte im Bundeshaus aufgegleist werden – wir sind zuversichtlich. Wird 2019 zur Wegmarke? Aufbruch statt Stagnation?
Das Ende der Zauberformel
Die gute alte Zauberformel zur Verteilung der Bundesratssitze hat ausgedient. Dies signalisiert ein neues Verständnis für Veränderungen, was natürlich nicht allen Parteien gelegen kommt. Wenn junge Kräfte das Machtkartell der etablierten Bewahrer in Frage stellen, wird der Weg geebnet für das Traktandieren essenzieller Zukunftsfragen. Seit Jahren stapeln sich solche im Warteraum, etwa das Verhältnis Schweiz zur EU, Massnahmen gegen die Klimaerwärmung, Antworten auf Globalisierung und Digitalisierung, Altersvorsorge.
Hoffnung keimt
„Die laufende Legislaturperiode ist eine verschwendete“, schrieb die NZZ im Frühling 2019 und „die kommenden Wahlen bringen zwar kaum Aussicht auf Besserung, allein, die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Dem ersten Teil dieses Satzes ist zuzustimmen, dem zweiten glücklicherweise nicht. Die Wahlen haben in weit grösserem Ausmass, als die Prognose-Auguren je dachten, die Ausgangslage im Bundeshaus verändert und das ist gut so.
In diesem Beitrag wird eine provisorische Liste der grossen helvetischen Baustellen aus persönlicher Sicht erstellt, sie ist nicht verbindlich, aber dringlich:
Verhältnis der Schweiz zur EU
Massnahmen gegen die Klimaerwärmung
Konsequenzen der Globalisierung und Digitalisierung
Altersvorsorge / Demografie
Landwirtschaft.
Verhältnis der Schweiz zur EU
Das An-Ort-Treten der verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in Sachen Schweiz–EU ist augenfällig. Vor den Herbst-Wahlen wollte sich niemand die Finger verbrennen. Also wartet man ab. Der Bundesrat wartet auf die Sozialpartner. Die Parteien auf den Bundesrat. Die Medien wissen (oder wissen sie es etwa gar nicht?), dass der vorliegende Vertragsentwurf beim Volk scheitern würde. Wenn sie sich auch diesmal täuschen, wenn das Volk eher das Ganze als Partikularinteressen im Fokus hätte? Abwarten und Tee trinken könnte sich eines Tages rächen.
Massnahmen gegen die Klimaerwärmung
Die gern herumgebotene klägliche Ausrede, die Schweiz könne den Klimawandel eh nicht stoppen, mag seine Richtigkeit haben. Doch nach dieser Ausrede in den neuen SUV (Realer Benzinverbrauch über 15l/km) zu sitzen und stolz zu verkünden, der Klimawandel sei ein natürlicher Prozess, wie es nach wie vor von gewissen Seiten der SVP tönt, ist angesichts der gegenteiligen Beweise schon fast sektiererisch. Das neue Parlament dürfte griffige Massnahmen, die den Namen verdienen, aufgleisen. Die Vorschläge des Professors von der Uni Freiburg, wie die Schweiz zum Vorbild für Europa mutieren könnte, sollten erhört werden. Auch zum finanziellen Vorteil der Schweizer Wirtschaft.
Konsequenzen der Globalisierung und Digitalisierung
So mit der Zeit realisieren wir die zwei Seiten der Globalisierung. Die steigenden Handelsvolumen und Produktionsverlagerungen haben mehr Wohlstand in grosse Teile der Welt gebracht. Doch leider, was bisher zu wenig zur Kenntnis genommen wurde: die Globalisierung schadet gleichzeitig der Umwelt; die Rodung der Regenwälder und die CO₂-Bilanz des riesigen Transportvolumens sind nur zwei der vielen Folgen. Im Nachklang zur Klimadebatte zeichnet sich ein Wandel im Konsumentenverhalten ab, der beide Trends betreffen wird.
Die Folgen der Digitalisierung werden vielerorts verteufelt, ähnlich wie es damals viele Arbeitende im Zug der Industrialisierung taten. Der Brand von Uster ist und bleibt ein Mahnmal für die Schweiz. Die Befürchtungen und Prognosen bezüglich steigender Arbeitslosen waren allesamt falsch. Sie sind es wohl auch heute.
Altersvorsorge/Demografie
Seit Jahren wissen wir um die Schieflage unserer AHV und Altersvorsorge. Die Alten (Rentner) im Land leben auf Kosten der Jungen, was die Langfristprognosen längst beweisen. Das heikle Thema wird von unseren Politikerinnen und Politikern in Bern schlicht verdrängt. Kein Ruhmesblatt.
Wie sich unsere Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten bezüglich Lebenserwartung verändern wird, es darf – entgegen den üblichen Prognosen – vor einer voreiligen Annahme gewarnt werden. Ein Szenario mit 110 Jahren Lebenserwartung für die heute Geborenen zu entwickeln, diese lineare Fortschreibung des aktuellen Trends, ist abenteuerlich. Es sei daran erinnert, dass in den USA die Lebenserwartung seit mehreren Jahren wieder abnimmt. Seit 75 Jahren hat sich noch jeder neue Gesellschaftstrend Jahre später auch in Europa manifestiert.
Landwirtschaft
Es ist zu hoffen, dass sich die Klimadebatte auch in der Schweizer-Landwirtschaft bemerkbar macht. Es braucht dringend neue Denkformen, weg von der „Subventionitis“. Wenn unser Trinkwasser bedenkliche Giftrückstände aufweist, wenn wir jährlich den eigenen Konsum mit Millionen von Schutzzöllen verteuern und z. B. Zucker anbauen, der uns ein Vielfaches kostet als im Welthandel – spätestens mit dem neu zusammengesetzten Parlament müssen die Alternativen auf den Tisch kommen. Es gibt mutige Perspektiven – sie müssen nur aus den Schubladen geholt werden.
Den Vorwurf der Reformunfähigkeit der Schweiz zu erheben sollte nicht als generelle Kritik missverstanden werden. Viel mehr gilt es zu bedenken, dass Reformvorschläge aus Liebe zur Heimat gedacht sind und um zu vermeiden, dass Reformen uns eines Tages vom Ausland aufgezwungen werden. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr eignen sich im besonderen Masse zum Nachdenken.
Hunde, wollt ihr ewig leben?
Man könnte heute den Ausspruch generell an Menschen richten, die nicht wie die Soldaten dem Schlachtentod, sondern dem Tod generell entfliehen wollen.
Das Fluchtmotiv sieht sich in jüngster Zeit durch eine medizinische Technologie bestärkt, welche die Lebensverlängerung ad libitum in machbare Reichweite heranzurücken verspricht. Die Biogerontologie entdeckt die Mechanismen des Alterns – dieser mysteriösen allgegenwärtigen Irreversibilität in der Natur – auf molekularer Ebene. Fiebrig suchen die Mikrobiologen nach dem Code im Genom, der den Alterungsprozess steuert und bestenfalls verlangsamt. Eine neue medizinische Enhancement-Technologie tritt neben die alte Medizin, mit der Devise: Nicht bloss Schutz, Reparatur und Wartung des menschlichen Körpers, sondern Verbesserung, Aufrüstung gegenüber jeglicher Art von Krankheit und Anfälligkeit. Ein Leben ohne Verfallsdatum. Wie dies ein Vertreter der Nanomedizin ausdrückt: „Das Fernziel der molekularen Nanotechnologie ist die Entwicklung einer Fabrikationstechnologie, die auf preiswerte Weise alle atomaren Anordnungen herstellen kann, die molekular reproduzierbar sind (...). Die molekulare Manufaktur wird in Bezug auf Präzision und Flexibilität neue Massstäbe schaffen.“
Der Mensch ist ein Transzendier-Tier
Solche Grossspurigkeit gehört zur Promotion und zum Marketing jeder neuen Technologie. Die Visionen machen jedoch die Rechnung ohne den Wirt, den Tod. Er ist ein absoluter Affront, eine tödliche persönliche Beleidigung. Wohl deshalb tritt er in westlichen Kulturen gern in personifizierter Gestalt auf, als Sensenmann, nicht als biologisches „factum brutum“. Die Personifizierung erlaubt auch, mit dem Tod zu verhandeln. Ein mittelalterliches Motiv ist etwa das Schachspiel mit dem Tod. Solange er einen nicht besiegt, kann man weiterleben. Hier macht sich schon zögernd das „transhumanistische“ Projekt bemerkbar, durch menschliche Ingeniosität – durch technische Tricks – den Tod zu überwinden.
Nun könnte man argumentieren, dass gerade die Unvollkommenheit, Unzulänglichkeit und Unerfülltheit uns als Menschen ausmachen. Sie evozieren unsere tiefsten Wünsche, unsere höchsten Visionen. Sie sind Antrieb zu den grössten menschlichen Leistungen. Und dieser Impuls – oder diese Obsession – macht den Menschen auch zu mehr als zu einem blossen biochemischen Überlebensapparat. Er ist das Lebewesen, das sich immer wieder selbst übersteigt: ein Transzendenz-Tier. So gesehen, stellt sich die Frage, ob denn ein beliebig verlängertes Leben nicht ausgerechnet diesen Spannungszustand zwischen Erreichtem und Noch-nicht-Erreichtem schwächen oder gar auslöschen könnte. Wir würden in die Lebensphase einer Agonie des besinnungslosen Glücks treten. Wir würden nicht mehr sterben, dafür aber stürbe wohl das Streben nach Glück.
Die subjektive Seite des Todes
Der Tod hat eine unauslöschliche subjektive Seite: er ist ganz und gar meiner. Dass ich einmal nicht mehr bin, definiert mit existenzieller Wucht, dass ich bin. Ich kann nicht heraustreten aus mir selbst und sagen: Schau, jetzt bin ich tot; oder: Schau, diese Person da, die identisch mit E. K. ist, ist jetzt nicht mehr. Der eigene Tod, so Martin Heidegger, ist „unvertretbar“: „Keiner kann dem anderen sein Sterben abnehmen.“ Oder mit Woody Allen zugespitzt: „Ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert.“
Auf diese Weise akzentuiert der Tod den unkittbaren Riss zwischen Subjekt und Objekt. Mein Körper ist ein objektives Vorkommnis in der Welt, aber zugleich ist er eben mein Körper. Und der Tod ist ein physikalisches, biologisches Ereignis in der Welt, das einen Organismus, ein Objekt, trifft. Zufälligerweise ist dieser Organismus auch gerade die Person E. K., also ein Subjekt, welches das Ereignis in der Welt auf seine ureigene Weise erfährt, als Ende seiner Zentralität. Wir versuchen, diesen Riss behelfsmässig mit irgendeinem metaphysischen Klebstoff zusammenzuhalten, letztlich kommen wir mit ihm nicht klar. Er ist etwas, das unser Fassungsvermögen übersteigt. „Das Falsche, das ist der Tod“, sagt Jean-Paul Sartre. Der Tod passt uns nicht in den Kram, aber wir müssen ihn akzeptieren. Er ist wahr. Er ist das wahre Falsche – eine Liaison dangereuse, die wir mit uns selbst eingehen und nicht aufkündigen können. Die Formulierung eines anderen berühmten Philosophen abändernd, könnte man von der Geburt der Subjekivität aus dem Geist des Todes sprechen.
Biologie ist systematisch einäugig
Die modernen Naturwissenschaften, zumal die Biologie, vertiefen diesen Riss nur. Ihr Blick ist der Blick auf Materie. Materielle Substanzen zerfallen und sie verwandeln sich in andere Substanzen – Leben ist eine einzige immense unablässige Transsubstantation. Aber der Mensch „lebt“ in diesem Sinn nicht, weil er als Person nicht zerfällt, sondern einfach nicht mehr ist. Die Person, die tot ist, ist nicht mehr Person, sondern Ding, also eine Verneinung der Person. Was nach dem Tod mit ihr geschieht, erweist sich nüchtern betrachtet als eine aussichtslose, funebre bis makabre Veranstaltung, die Verneinung wieder aufzuheben. Mit welchem Pomp man den Kadaver untot erscheinen lassen will – Schminken, Einbalsamieren, Zelebrieren –, er bleibt das Leichenstück, das er ist.
Biologie ist systematisch einäugig, gerade indem sie die „natürliche“ Lebensspanne durch die Erhaltung des Lebensapparats Körper auszudehnen versucht. Sie sieht im Leben komplexe Prozesse zwischen Zellen, nicht die Geschichte von Personen. Auf jeden Fall ist das Phänomen des Alterns etwas, das die Biologie übersteigt. Was selbstverständlich nicht ausschliesst, dass die Biologie wesentliche Einsichten in dieses Phänomen zu liefern vermag, in Zukunft wahrscheinlich sogar solche, von denen wir uns heute noch kaum klare Vorstellungen machen können – „unknown unknowns“.
Umlagern der Pathologie
Dazu muss man auch problematische Konsequenzen der Altersverlängerung zählen. Zum Beispiel die Frage der Behandlungsgerechtigkeit: Kämen nur zahlungsstarke Menschen in den Genuss lebensverlängernder Massnahmen? Oder man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der sich die Generationen nicht so sehr ablösten als vielmehr koexistierten, sozusagen Parallelpopulationen. Wie ginge man mit einer nicht mehr alternden Weltbevölkerung um? Der Mensch wäre dann zwar „unsterblich“, aber bliebe tötbar. Müsste man dann zur „Ersetzung“ von Menschen nicht sogar nicht-natürliche Todesarten ins Auge fassen, etwa verordneten Suizid oder Exit-Roulette?
Und ganz allgemein stellt sich die Frage der Krankheit. Angenommen, es gelingt uns zum Beispiel, die Häufigkeit einer Krankheit im Alter von 70 Jahren zu vermindern. Das schlösse allerdings nicht aus, dass die Krankheit im Alter von 90 oder 100 Jahren doch noch auftreten würde. Man hätte sie einfach hinausgeschoben, was man durchaus als aktuelle, jedoch nicht als generelle Heilung betrachten kann. Bezieht man das Krankheitsrisiko auf das ganze Leben, würden Menschen nach wie vor an altersbedingten Krankheiten sterben, bloss einfach betagter. Krankheiten sind wie eine Hydra. Schlägt man ihr einen Kopf ab, so wachsen an einer anderen Stelle, zu einem anderen Zeitpunkt andere Köpfe nach. Es gibt keinen lebenslangen Schutz vor Krankheit, bloss ein Umlagern der Pathologie. Und wer weiss schon, welche neuen Pathologien auf den Menschen warten, wenn er einmal ein Alter von 130 Jahren erreichen kann.
Wert hat etwas, das man verlieren kann
Wie viele „unbekannte Unbekannte“ uns die Möglichkeit der Altersverlängerung auch bescheren wird, eine bekannte Unbekannte bleibt: der Tod. Er ist das „Jenseitige“ schlechthin. Er lässt sich nicht ins Diesseits von wissenschaftlicher und technologischer Rationalität holen. Und er lehrt uns im Grunde den Wert des Lebens. Denn einen Wert kann nur etwas haben, das man verlieren kann. Zwischen Leben und Tod vermittelt eine scharfe Ausschlussrelation. Epikur hat sie auf eine Formel gebracht: „So ist (...) der Tod (...) für uns ein Nichts: solange wir da sind, ist er nicht da, und wenn er da ist, sind wir nicht mehr.“ Zugegeben, das ist nicht leicht verträgliche Lebenskost. Ich bin auf einen banaleren Trost gestossen. In einem Roman las ich vor kurzem den Satz: Wenn man mit 50 am Morgen aufwacht und keine Schmerzen hat, ist das ein untrügliches Zeichen, dass man tot ist. Ich bin über 70 und wache mit Gliederschmerzen aufgrund eines Velounfalls im Frühling auf. Wenn das nicht zuversichtlich stimmt ...
Keiner schoss so viele Tore wie er
10’000 Menschen hatten dem prominenten Hochzeitspaar am 24. August 1985 in Schwyz zugejubelt.
In 313 Spielen hatte Fritz Künzli 201 Treffer erzielt – ein noch heute bestehender Rekord. Zwei Mal war er mit dem FC Zürich Schweizer Meister, vier Mal Cup-Sieger. Und vier Mal war er in seiner Karriere Torschützenkönig.

In 44 Einsätzen in der Nationalmannschaft schoss der Glarner 15 Tore für die Schweiz.
Zusammen mit Köbi Kuhn dominierte er lange den Sturm des FC Zürich. „Jetzt finden sich die beiden wieder im Himmel und werden sicher eine Fussballmannschaft gründen“, heisst es in den sozialen Medien.
Fritz Künzli spielte vor allem beim FC Zürich, später beim FC Winterthur, dann bei Lausanne-Sports, San Diego Soccers/Houston Hurricane und wieder bei Lausanne.
Künzli starb am Sonntagmorgen in der Klinik Hirslanden in Zürich. Seit langem litt er an einer schweren Demenzkrankheit. Monika Kälin pflegte und betreute den Kranken bis zum Schluss. Die Beerdigung findet am 8. Januar statt, an seinem Geburtstag.
Der FC Zürich verlor in diesem Jahr gleich drei ehemalige Top-Spieler: Neben Köbi Kuhn und Fritz Künzli starb im April der legendäre FCZ-Torhüter Karl Grob.

(J21)

Jean Cocteau
Gute Erziehung besteht darin, dass man verbirgt, wie viel man von sich selber hält und wie wenig von den anderen.
Eine Weihnachtsgeschichte
Was es für Geflüchtete heisst, hier in der Fremde eine Arbeit, einen Ausbildungsplatz oder eine Wohnung zu finden, darüber wissen wir wenig. Denn nur selten kommen Flüchtlinge selbst zu Wort. Deshalb gebe ich hier die Geschichte von Kidane (*) weiter, einem jungen Mann aus Eriträa.
«Ich heisse Kidane, habe jetzt zwei Töchter – eine hier und eine in Eriträa. Ich bin im Jahr 2015 wegen der Diktatur in die Schweiz geflüchtet. Die Polizei hat meine Mutter mehrmals ins Gefängnis gesteckt und sie ermutigte mich, zu fliehen.
Dabei hatte ich in der Schweiz viel Glück, denn ich habe zwei freiwillige Betreuerinnen erhalten, die mich in allem unterstützten, so auch beim Deutschunterricht. Die freiwilligen Frauen sind mir in allen Lebensschwierigkeiten beigestanden. Ich bin sehr dankbar, dass es solche Menschen in der Schweiz gibt. Ohne sie wäre mein Leben schwieriger. Ich konnte damals nur mit Medikamenten schlafen.
Durch die Freiwilligen habe ich 2017 einen Bauern kennengelernt, bei dem ich zwei- bis dreimal in der Woche freiwillig arbeiten konnte. Nach drei Jahren erhielt ich 2018 meine Aufenthaltsbewilligung F und meine Frau ist dann selber in die Schweiz geflüchtet.
Nach meinem Asylentscheid hat mir der Sozialarbeiter den Deutschkurs gestrichen und mich in ein Beschäftigungsprogramm geschickt. Dort war ich überfordert, weil ich noch nicht genügend Deutsch konnte und während 6 Tagen pro Woche arbeiten musste. Dies würde eigentlich dem Arbeitsgesetz widersprechen, aber niemand setzte sich für mich ein. Pro Monat habe ich dafür 50 Franken verdient. Am Ende habe ich ein Zeugnis erhalten, das mir später geholfen hat.
Ich habe dem Sozialamt gesagt, dass ich arbeiten möchte. Das Sozialamt hat mich zum RAV geschickt. Nur dank meiner Betreuerinnen schaffte ich es, pro Monat 13 Bewerbungen zu verschicken. Alleine wäre dies nicht möglich gewesen.
2019 kam meine zweite Tochter auf die Welt und dann wurde ich bei einem Gärtner angestellt. Nach ein paar Monaten hat mir mein Arbeitgeber vorgeschlagen, bei ihm eine Lehre zu machen. Eigentlich hätte ich das gern getan, aber ich vermisse meine sechsjährige Tochter in Eriträa und möchte sie gerne zu uns in die Schweiz holen. Wenn ich aber eine Ausbildung mache und deswegen noch Sozialhilfe bekomme, darf ich meine Tochter nicht hierherbringen. Mein Plan war es, später eine Ausbildung zu machen.
Schliesslich hat mir meine Sozialarbeiterin – die ich heute als sehr hilfreich erlebe, was aber nicht immer der Fall war – erklärt, dass ich meine Tochter sowieso nicht in die Schweiz bringen kann, da ich nach der Bewilligung zuerst drei Jahre warten muss. Also haben wir uns dazu entschieden, dass ich eine Ausbildung als Verkäufer bei der Gärtnerei anfange. Das ist gut für meine Zukunft, aber es verzögert den Moment, meine ältere Tochter bei uns zu haben.
Meine Erfahrungen der letzten Jahre sind vielseitig. Viel Dankbarkeit, aber auch viele Schwierigkeiten. Die Schweizer wissen nicht, wie es ist, drei Jahre in einem Asylheim zu leben, als Flüchtling eine Wohnung zu suchen, die Familie und die Kinder in einem anderen Land zu haben und jahrelang auf einen Entscheid zu warten. Die Gesetze werden immer wieder verschärft.
Ich arbeite hart und mache eine Ausbildung und gebe mein Bestes, um mich zu integrieren, aber mein Herz und meine Gedanken sind bei unserer älteren Tochter. Wann wird sie bei uns sein?»
Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit der Geburt eines Kindes, fernab der Heimat, unter prekären Verhältnissen. Nach der Geburt flieht die Familie nach Ägypten, da sie politisch verfolgt wird. Die Weihnachtsgeschichte ist auch eine Fluchtgeschichte.
Kidane hat seine Geschichte an einer Veranstaltung zur Arbeitsintegration von «unsere Stimmen – NCBI Schweiz» erzählt. Es wurde die Frage gestellt, warum Flüchtlinge uns Angst machen, ob wir nicht anders über Flüchtlinge sprechen würden, wenn wir anerkennen würden, dass ein Mensch ein Mensch bleibt, egal wo er sich unter welchen Umständen befindet. Menschen haben das Recht, als Mensch behandelt zu werden. Dazu gehört auch das Recht, aus einer Situation zu fliehen, die für einem selber und seine Familie gefährlich werden kann. Wir alle würden so handeln, wen wir uns in prekären Situationen befinden würden.
Weihnachten ist nicht nur eine Fluchtgeschichte, Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Die Geschichte von Kidane gehört dazu.
(*) Name geändert
TROUVAILLES
«The Guardian»: «Little town of Bethlehem – a travel photo essay» by Rebecca Ratcliffe
«The Guardian»: «Working Report»
«The Guardian»: «Podcast – The election fallout: what happens next?»
«The New Yorker»: «The Art of Dying» by Peter Schijedahl
«The New Yorker»: «Pete Buttigieg’s High Hopes» by Benjamin Wallace-Wells
«The New Yorker»: «The Field Guide to Tyranny» by Adam Gopnik
«The New Yorker»: «Trump’s Impeachment Timeline and the 2020 Election» by Amy Davidson Sorkin
«The New York Review of Books»: «Is Trump Above the Law?» by Noah Feldman
«The New York Review of Books»: «The Rising Cost of Not Living» by Mona Chalabi (text and art)
«The New York Review of Books»: «Meaning and Mayhem» by Roberto Saviano
«The Washington Posts»: «The Afghan Papers VI: Overwhelmed by Opium» by Craig Whitlock
«The Washington Post»: «What’s next for Trump?» by Amber Phillips
«The Washington Post»: «The House has impeached Trump. But in a sense, he has won» by Dana Milbank
«The Washington Post»: «The best movies of 2019» by Ann Hornaday
«The New York Times»: «The Supreme Court’s Final Exam» by Linda Greenhouse
«The New York Times»: «Where Doctors Are Criminals »
«The New York Times»: «A Longing for the Lost Landline» by Roger Cohen
«The New York Times»: «The Decade When Tech Lost Ist Way: An Oral History of the 2010s»
«The New York Times»: «What We Learned in Science News 2019 »
«The New York Times»: «The Best Comics of 2019» by Hillary Chute & Ed Park
«The New York Times»: «As a Disorienting Decade Closes, a Perilous One Begins» by Roger Cohen
«The New York Times»: «The Decade in Pictures»
«The New York Times Magazine»: «The Case of the Angry Daugher» by Rivka Galchen
«Lapham’s Quarterly»: «How to Survive Winter» by Bernd Brunner
..........Kalenderwoche 50..........
«The Washington Post»: «The Case for Impeachment» by Editorial Board
«The Washington Post»: «The Afghanistan Papers I: At War With The Truth» by Craig Whitlock
«The Washington Post»: «The Afghanistan Papers II: Stranded Without a Strategy» by Craig Whitlock
«The Washington Post»: «The Afghanistan Papers III: Built to Fail» by Craig Whitlock
«The Washington Post»: «The Afghan Papers IV: Consumed by Corruption » by Craig Wthitlock
«The Washington Post»: «The Afghan Papers V: Unguarded Nation» by Craig Whitlock»
«The New Yorker»: «Hong Kong’s Protest Movement and thje Fight for the City’s Soul» by Jiayang Fan
«The New Yorker»: «Letter from Moscow: The Kremlin’s Creative Director» by Joshua Jaffa
«The New Yorker»: «Sunday Readings: Winter Adventures» by The New Yorker
«The New York Times»: «The Year in Pictures» by Dean Bacquet
«The New York Times»: «The Year in Climate Change»
«The New York Times»: «Impeach» by The Editorial Board
«The New York Times»: «Impeach Trump. Save America» by Thomas L. Friedman
«The New York Times»: «Lots of Lessons from Afghanistan; None Learned» by The Editorial Board
«The New York Times»: «The War That Continues to Shape Russia, 15 Years Later» by Andrew Higgins
«The New York Times»: «Nonfiction: The Military’s Illusions About Donald Trump» by Eliot A. Cohen
«The New York Times»: «Boris Johnson and the Coming Trump Victory in 2020» by Roger Cohen
«The New York Times Magazine»: «The Best Actors of 2019» by A.O. Scott & Wesley Morris
«The New York Times»: «Who Is Sanna Marin, Finland’s 34-Year-Old Prome Minister?» by Megan Specia
«The Guardian»: «General Election Recap: Johnson Ascendant »
«The Guardian»: «’Sometimes the world goes feral’: 11 odes to Europe»
«The Guardian»: «Agency photographer of the year – 2019 shortlist»
«The Intercept» : «U.S. Sanctions Are Driving Iran to Tighten Its Grip on Iraq» by James Risen
«Rolling Stone»: «The RS 2020 Democratic Primary Leaderboard » by Rolling Stone
«Poynter»: «The scary trend of internet shutdowns» by Daniela Flamini
«Wired»: «Instagram, My Daugher and Me» by Duff McDonald
..........Kalenderwoche 49..........
«The Guardian»: «Are drone swarms the future of aerial warfare?» by Michael Safi
«The Guardian»: «Kochland review: how the Kochs bought America – and trashed it» by Charles Kaiser
«The Observer»: «»Back to the border of misery: Amexica visited 10 years on» by Ed Vulliamy
«The Observer»: «A-Z of climate anxiety: how to avoid meltdown» by Emma Beddington
«The Observer» : «The best graphic novels of 2019» by Rachel Cooke
«The Guardian»: «Podcast- Hillsborough: the 30-year fight for justice»
«The Atlantic»: «Top 25 News Photos of 2019» by Alan Taylor
«The Atlantic»: «Hopeful Images from 2019»
«The New York Times» : «For Trump and Europe, A Surpsising Role Reversal» by Mark Landler
«The New York Times»: «Iran Is Crushing Freedom One Country At a Time» by Thomas L. Friedman
«The New York Times»: «The Class of 2000 ‘Could have Been Anything’, Until Opioids Hit» by Dan Levin
«The New York Times»: «The Unending Indignieties of Alzheimer’s» by Jeneen Interlandi
«The New York Times»: «A Better Internet Is Waiting for Us » by Annalee Newitz
«The New York Times»: «33 Ways to Remember the 2010s»
«The New York Times Magazine» : «I Worked for Alex Jones. I Regret It» by Josh Owens
«The New Yorker»: «A Reporter At Large: Blood and Soil in Narendra Modi’s India» by Dexter Filkins
«The New Yorker»: «Dept. Of Innovation: Taking Virtual Reality for a Test Drive» by Patricia Marx
«The New Yorker»: «The Next Steps in the Impeachment Inquiry» by Amy Davidson Sorkin
«The New Yorker»: «The Best Books of 2019» by Katy Waldman
«The New Yorker»: «The Twenty-Seven Best Movies of the Decade» by Richard Brody
«The New York Review of Books»: «The Drums of Cyberwar» by Sue Halpern
«The Washington Post»: «Lives adrift in a warming world»
«The Washington Post»: «A language for all» by Samantha Schmidt
«The Washington Post»: «Ghosts of the Future» by Sarah Kaplan
«The Washington Post»: «This is what the Trump economy looks like» by Philip Bump
«Columbia Journalism Review»: «The Fact-Check Industry» by Emily Bell
..........Kalenderwoche 48..........
«The New York Times»: «Who Will Tell the Truth About the Free Press?» by The Editorial Board
«The New York Times»: «Lost and Found in Hemingway’s Spain» by Roger Cohen
«The New York Times»: «Tiffany Is More Than a Store» by Vanessa Friedman
«The New York Times»: «What the Impeachment Hearings Look Like from Europe» by Jochen Bittner
«The New York Times»: «How Amazon Wove Itself Into the Life of an American City» by Scott Shane
«The New York Times»: Activists Build a Grass-Roots Alliance Against Amazon » by David Streifeld
«The New York Times»: «100 Notable Books of 2019»
«The New York Times Book Review»: «Christmas Books»
«The New Yorker»: «Hurricane Season» by David Sedaris
«The New Yorker»: «Brave New World Dept.: Big Tech’s Big Defector» by Brian Barth
«The New Yorker»: «Books: It’s Still Mrs. Thatcher’s Britain» by James Wood
«The New York Review of Books»: «How China’s Rise Has Fastened Hong Kong’s Decline » by Ian Johnson
«The Washington Post»: «What we still don’t know about the Ukraine affair» by Jackson Diehl
«The Washington Post» : «A call of duty and the family he left behind» by Ian Shapira
«The Washington Post»: «50 notable works of fiction in 2019»
«The Washington Post»: «50 notable work of nonfiction in 2019»
«The Guardian»: «The media like to rock the royal boat – but they won’t sink it» by Roy Greenslade
«The Guardian»: «Podcast – The rise of Netflix. An empire built on debt»
«The Guardian»: «Digital democracy will face ist biggest test in 2020» by Siva Vaidhyanathan
«The Guardian»: «Tim Berners-Lee unveils global plan to save the web» by Ian Sample
«The Guardian»: «Murals of Baghdad : the art of protest»
«The Observer»: «Faith, but fury too, for Donald Trump at home» by Michael Goldfarb
«The Observer»: «Fun, physics and the God particle: a tour of Cern, Switzerland» by Emma Cook
«Columbia Journalism Review»: «Building a more honest Internet» by Ethan Zuckermann
«Columbia Journalism Review»: «The Investigator» by Elizabeth Zerofsky
..........Kalenderwoche 48..........
«The New York Times» : «Fiona Hill and the American Idea» by Roger Cohen
«The New York Times»: «Colonel Windman’s America» by Jesse Wegman
«The New York Times»: «Why Fox News Slimed a Purple Heart Recipient» by Tonin Smith
«The New York Times»: «The-Nehisi Coates: The Cancellation of Kolin Kaepernick» by Te-Nehisi Coates
«The New York Times»: «Hong Kong: A City Divided» by Lam Yik Fei (photographs)
«The New York Times»: «Vacillating Trump Supporter, Take Two» by Roger Cohen
«The New York Times»: «The Jungle Prince of Delhi» by Ellen Barry
«The New York Times»: «Non-Fiction: Seeing Margaret Thatcher Whole» by Benjamin Schwarz
«The New York Times»: «The 10 Best Books of 2019»
«The New York Times Magazine»: «Congratulations, You’re a Congresswoman. Now What?» by Susan Dominus
«The New York Times Style Magazine»: «Japan in Bloom» by Hanya Yanagihara
«The New Yorker»: «Annals of Inquiry: Dirt-Road America» by M.R. O’Connor
«The New York Review of Books»: «The Medium Is the Mistake» by David Bromwich
«The New York Review of Books»: «The Ceaseless Innovation of Duane Michals» by Martin Filler
«The New York Review of Books»: «Against Economics» by David Graeber
«The Washington Post»: «Why it was so satisfying to watch Fiona Hill take charge» by Rechel Sklar
«The Washington Post»: «Lee Harvey Oswald’s final hours before killing Kennedy»
«The Guardian»: «Streets on fire: how a decade of protest changed the world» by Gary Younge
«The Guardian»: «Facebook: ‘Greatest propaganda machine in history’» by Sacha Baron Cohen
«The Guardian»: «The long read: what I have learned form my suicidal patients» by Gavin Frances
«The Guardian»: «Ten of the best new books in translation» by Marta Bausells
«The Guardian»: «Glimpses of women through time: 130 years of National Geographic images»
«The Guardian»: «Foetus 18 weeks: the greatast photograph of the 20th century?» by Charlotte Jansen
«The Observer»: «How street protests across Middle Easr theaten Iran’s power» by Martin Chulov
«The Intercept»: «The Story Behind the Iran Cables» by Betsy Reed, Vanessa Gezari & Roger Hodge
..........Kalenderwoche 47..........
«The Guardian»: «Czechoslovakia’s Velvet Revolution, 1989 – in pictures»
«The Guardian»: «Podcast: Meeting George Soros»
«The Intercept»: «Deconstructed: The Bernie Sanders Interview»
«The Intercept» : «Baghdadi Died, but the U,S. War on Terror Will Go On Forever» by Murtaza Hussain
«The Washington Post»: «Iran’s Hostage Factory» by Jason Rezaian
«The Washington Post»: «Fear and loathing ahead of the British election» by Adam Taylor
«The Washington Post»: «Hong Kong: ‘We’re in a war’» by Shibani Mahtani
«The New Yorker»: «Personal History: The Final Frontier» by Michael Chabon
«The New Yorker»: «A Reporter At Large: The Case Against Boeing» by Alec MacGillis
«The New Yorker»: «From Little Englanders to Brexiteers» by Issac Chotiner
«The New Yorker»: «Is Trump Already Winning on Impeachment?» by Susan B. Glasser
«The New York Times»: «In Praise of Washington Insiders» by David Brooks
«The New York Times»: «On the Frontline of Progressive Anti-Semitism» by Blake Fleyton
«The New York Times»: «What Joe Biden Actually Did in Ukraine» by Glen Thrush & Kenneth P. Vogel
«The New York Times»: «The Soldiers We Leave Behind» by Phil Klay
«Foreign Affairs»: «Let Russia Be Russia» by Thomas Graham
«Rolling Stone»: «Why Venice Is Disappearing» by Jeff Goodell
..........Kalenderwoche 46..........
«The Guardian»: «After Baghdadi: who are the world’s most wanted fugitives?» by Michael Safi
«The Guardian»: «Berlin after the Wall – then and now» by Colin McPherson (photographs)
«The Guardian»: «The briefing: whatever happened to the Berlin Wall?» by Kate Connolly
«The Guardian»: «Podcast: Mexico’s war with the drug cartels»
«The Guardian»: «How Big Tech is dragging us towards the next financial crash» by Rana Foroohar
«The Observer»: «How the megacities of Europe stole a continent’s wealth» by Julian Coman
«The New Yorker» : «Personal History: My Year of Concussions» by Nick Paumgarten
«The New Yorker»: «Liberalism According to The Economist» by Pankaj Mishra
«The New York Review of Books»: «The Defeat of General Mattis» by Fred Kaplan
«The New York Review of Books»: «Lesssons in Survival» by Emily Raboteau
«The New York Times»: «How a Tell-All Memoir Made It into Print » by Alexandra Alter
«The New York Times»: «How One Syrian Highwy Shows a Country in Chaos» by Neil Collier & Ben Laffin
«The New York Times»: «Why Donald Trump Hates Your Dog» by Frank Bruni
«The New York Times»: «Latin Americans Are Furious» by Jorge Ramos
«The New York Times»: «Philip Glass Is Too Busy to Care About Legacy» by Zachary Wolfe
«The New York Times» : «Op-Art: A Wedding Under Curfew» by Malik Sajad
«The New York Times»: «Warren Would Take Billionaires Down a Few Billion Pegs» by Patricia Cohen
«The New York Times Magazine»: «Inside Adam Schiff’s Impeachment Game Plan» by Jason Zengerle
«The Washington Post» : «Podcast – The other Frankfurt – an East German city grapples with identity»
«The New Republic»: «The Death of the Rude Press» by Alex Pareene
..........Kalenderwoche 45..........
«The New York Times»: «The Happy, Healthy Capitalists of Switzerland» by Ruchir Sharma
«The New York Times» : «Can Democrats Compete with Trump’s Twitter Feed?» by Charlie Warzel
«The New York Times»: «The Arab Spring Rekindled in Beirut» by Roger Cohen
«The New York Times»: «Aaron Sorkin: An Open Letter to Mark Zuckerberg» by Aaron Sorkin
«The New Yorker»: «In His Dealings with Ukaine, Did Donald Trump Commit a Crime?» by Jeffrey Toobin
«The New Yorker»: «How Brexit Will End» by Sam Knight
«The New Yorker»: «A Critic at Large: Why We Can’t Tell the Truth About Aging» by Arthur Krystal
«The Washington Post»: «Three big questions after Baghdadi’s death» by Ishaan Tharoor
«The Washington Post»: «The anti-neoliberal wave rocking Latin America» by Ishaan Tharoor
«The Washington Post Magazine»: «The Spectacular, Strange Rise of Music Holograms» by David Rowell
«The Washington Post Magazine»: «The Apology Letter» by John J. Lennon
«The Intercept»: «Podcast: How to resist with Ilhan Omar and Michael Moore»
«The Intercept»: «Deconstructed Special: The Noam Chomsky Interview»
«The Guardian»: «Has the climate crisis made California too dangerous to live in?» by Bill McKibben
«The Guardian»: «Robert de Niro and Al Pacino: ’Were not doing this ever again’ by Andrew Pulver
«The Guardian»: Cannabis farms and nail bars: the hidden world of human trafficking»
«The Observer»: «Frustration and anger fuel wave of youth unrest in Arab world» by Michael Safi
«Wired»: «What’s Blockchain Actually Good For? For Now, Not Much» by Gregory Barber
«The Atlantic»: «Brexit and the Failure of Journalism» by Helen Lewis
..........Kalenderwoche 44..........
«The New York Times»: « Al-Baghdadi Is Dead. The Story Doesn’t End Here» by Thomas L. Friedman
«The New York Times»: «Why Protests Are Flaring Up Across the Globe» by Declan Walsh & Max Fisher
«The New York Times»: «Extra! Extra! Prez Won’t Read All About It» by Maureen Dowd
«The New York Times»: «An Election Is the Only Answer for Britain» by Roger Cohen
«The New York Times Magazine»: «The Illustrated Guide to Brexit» by Christoph Niemann
«The New Yorker»: «Dispatch: How to Mourn a Glacier» by Lacy M. Johnson
«The New Yorker»: «The Shattered Dream of Afghan Peace» by Luke Mogelson
«The New Yorker»: «Modern Life: Astrology in the Age of Uncertainty» by Christine Smallwood
«The New Yorker»: «The Invention – and Reinvention – of Impeachment» by Jill Lepore
«The Washington Post»: «The words that could end a presidency» by Dana Milbank
«The Washington Post»: «’I don’t think they know we exist’» by Stepahnie McCrummen
«The Guardian»: Five brothers, five countries : a family ravaged by Syria’s war» by Michael Safi
«The Guardian»: «I watched Fox News every day for 44 months: Here’s what I learned» by Bobby Lewis
«The Guardian»: «In its deference to the powerful, our media is failing us» by Gary Younge
«The Guardian»: «No filter: my week-long quest to break out of my political bubble» by John Harris
«The Guardian»: «All the President’s women review: Donald Trump, sexual predator» by Lloyd Green
..........Kalenderwoche 43..........
«The New York Times»: «How Italians Became ‘White’» by Brent Staples
"The New York Times": «In the Alps, Keeping Tabs on Melting Ice» by Page McClanahan
«The New York Times»: «How Can Democrats Keep Themselves From Overreaching» by Thomas B. Edsall
«The New York Times»: «How Hitler Pioneered ‘Fake News’» by Timothy Snyder
«The New York Times Style Magazine»: «The Greats»
«The New Yorker»: «Iran’s Housing Crisis: The Ghost Towers» by Hashem Shakeri
«The New Yorker»: «Will Republicans Challenge Trump on Impeachment» by Amy Davidson Sorkin
«The New Yorker»: «The Exuberance of MoMa’s Expansion» by Peter Schjeldahl
«The Washington Post»: «The Democratic Debates Haven’t Changed Much? Oh, yes they have» by Dan Balz
«The Washington Post»: «The akward tension underlying the West’s anger at Turkey» by Ishaan Tharoor
«The Guardian»: «Russian shadow falls over Syria as Kurds open door for Assad» by Martin Chulov
«The Guardian»: «Podcast – Hong Kong: the story of one protester»
«The Guardian: «We’re rethinking the images we use for our climate journalism» by Fiona Shields
«The London Review of Books»: «Chinese Cyber-Sovereignty» by John Lanchester
«The London Review of Books»: «Hipsters in Beijing» by Sheng Yun
«Rolling Stone»: «The Biden Paradox» by Matt Taibbi
«Rolling Stone»: «Elijah Cummings Was Not Done» by Jamil Smith
«The Atlantic»: «Jeff Bezos’s Master Plan» by Franklin Foer
«Foreign Affairs»: «The Demolition of U.S. Diplomacy» by William J. Burns
..........Kalenderwoche 42..........
«The New York Times»: «The Free World at 30» by Roger Cohen
«The New York Times»: «Revisiting Hitler, in a New Authoritarian Age» by Talya Zax
«The New York Times»: «What Happened to Rudy Giuliani?» by Ken Frydman
«The New York Times»: «A Linguist’s Guide to Quid pro Quo» by Steven Pinker
«The New York Times»: «Do Works by Men Toppled by #MeToo Belong in the Classroom?» by Emma Goldberg
«The New York Times»: «10 Tips to Avoid Leaving Tracks Around the Internet» by David Pogue
«The New York Times Magazine»: «How Susan Sontag Taught Me to Think» by A. O. Scott
«The New York Times Magazine»: «What Does PewDiePie Really Believe?» by Kevin Roose
«The New Yorker»: «Is Amazon Unstoppable?» by Charles Duhigg
«The New Yorker»: «Amartya Sen’s Hopes and Fears for Indian Democracy» by Isaac Chotiner
«The New Yorker»: «Cultural Comment: How We Came to Live in ‘Cursed’ Times» by Jia Tolentino
«The New Yorker» : «Annals of Philisophy: Nietzsche’s Eternal Return» by Alex Ross
«The New York Review of Books» : «Harald Szeemann: Curatiom as Creation» by Jason Farago
«The New York Review of Books»: «Time for a New Liberation?» by Timothy Garton Ash
«The New York Review of Books»: «Fascinated to Presume: In Defense of Fiction» by Zadie Smith
«The Washington Post»: «Donald Trump, corrupted absolutely» by Dana Milbank
«The Washington Post»: «Five Myths about Mike Pence» by Tom LoBianco
«The Guardian»: «Podcast: Thirteen children have been shod dead in St. Louis, Missouri. Why?»
«The Guardian»: "Bloodied clothes and body bags: Kurds mourn dead in Syria» by Martin Chulov
«The Guardian»: «The long read: Haiti and the failed promise of US aid» by Jacob Kushner
«Dissent Magazine»: «The Obamanauts» by Corey Robin
«Literary Hub»: «On Finding the Freedom to Rage Againgst Our Fathers» by Minda Honey
«Longreads»: «How to Survive a Vivisection» by Rachel Somerstein
«The Atlantic»: «The Danger of Abandoning Our Partners» by Joseph Votel & Elizabeth Dent
..........Kalenderwoche 41..........
«The New York Times»: «The Growing Threat to Journalism Around the World» by A. G. Sulzberger
«The New York Times» : «Why Trump Voters Stick with Him» by David Brooks
«The New York Times»: «Touch of Evil» by Maureen Dowd
«The New York Times»: «Free Speech Is Killing Us» by Andrew Marantz
«The New York Times»: «What’s the Matter with Republicans?» by Peter Wehner
«The New York Times»: «What Kind of Problem Is Climate Change?» by Alex Rosenberg
«The New York Times»: «In the Land of Self-Defeat» by Monica Potts
«The New York Times»: «Nonfiction: Can We Trust Economists?» by Justin Fox
«The New York Times»: «How ICE Picks Ist Targets in the Surveillance Age» by McKenzie Funk
«The New York Times»: «The New MoMa Is Here. Get Ready for Channge» by Jason Fargo
«The New Yorker»: «Letter From Trump’s Washington: Did Trump Just Self-Impeach» by Susan B. Glasser
«The New Yorker»: «How Far Will Trump Go to Save Himself?» by John Cassidy
«The New Yorker»: «How Disinformation Reaches Donald Trump» by David Rhode
«The New Yorker»: «Personal History: Abandoning A Cat - Memories of My Father» by Haruki Murakami
«The New York Review of Books» : «Snowden in the Labyrinth» by Jonathan Lethem
«The New York Review of Books»: «When Fathers Die: Remembering Robert Frank» by Danny Lyon
«The Washington Post»: «Trump won’t destroy me, and he won’t destroy my family» by Joe Biden
«The Washington Post»: «Love and war» by Karie Fugett
«The Guardian»: «Amal Clooney: give UN power to investigate journlist death» by Patrick Wintour
«The Observer»: «Behind the razor wire of Greece’s notorious refugee camp» by Daniel Howden
«The Observer»: «From ‘our girls’ to ‘brides of Isis’» by Azadeh Moaveni
«The Observer»: «Final edition : why no local news is bad news» by Tim Adams
«Insider»: «The Murder of Kamal Kashoggi» by Evan Ratliff
..........Kalenderwoche 40...........
«The New York Times»: «When Trump Feels Cornered, He Gets Worse» by Roger Cohen
«The New York Times»: «Impeaching the Peach One» by Maureen Dowd
«The New York Times»: «Why the Trump Impeachment Inquiry is the Only Option» by The Editorial Board
«The New York Times»: «Nonfiction: The Inscrutable Mike Pence» by Peter Baker
«The New York Times»: «When Depression Is Like A Cancer» by Jill Halper M.D.
«The New York Times» : «36 Hours in Geneva» by Paige McClanahan
«The New York Times»: «In the Swiss Alps, Walking a Cliff’s Edge to History» by Andrew Brenner
«The New York Times»: «Saudi Arabia Invites Tourists: What You Need to Know» by Tariro Mzezewa
«The New Yorker»: «Nancy Pelosi: An Exremely Stable Genius» by David Remnick
«The New Yorker»: «Annals of Medicine: Paging Dr Robot» by D.T. Max
«The New Yorker»: «Can a Burger Help Solve Climate Change?» by Tad Friend
«The New Yorker»: «The Integrity oft he Trump Impeachment Inquiry» by Steve Coll
«The New York Review of Books»: «Songs of my Self-Care» by Jacqueline Rose
«The Washington Post» : President sees himself as victim like no other» by Philip Rucker
«The Intercept»: «More U.S. Commandos Are Fighting Invisible Wars in the Middle East» by Nick Turse
«The Guardian»: «A 2'000km journey through the Amzon rainforest»
«The Guardian» : «A Life in a Sea of Red: the rise of China – in pictures» by Liu Heung Shing
«The Guardian»: «The long read: How Turkish TV is taking over the world» by Fatima Bhutto
«The Guardian»: «The 100 best films of the 21st century»
«The Guardian»: «The 100 best albums oft he 21st century»
..........Kalenderwoche 39..........
«The New York Times»: «Why Trump’s Daring Gambit with the Taliban Stalled» by Mujib Mashal
«The New York Times»: «Bibi Netanyahu Trapped in His Own Labyrinth» by Roger Cohen
«The New York Times» : «The End of the Netanyahu Era» by Shmuel Rosner
«The New York Times»: «Barack Obama’s Biggest Mistake» by Farhad Manjoo
«The New York Times»: «Rock Star Patty Smith, Making Paris Swoon» by Maureen Dowd
«The New York Times» : «The Views from the Top: How They Measure Up» by James S. Russell
«The New Yorker»: «Edward Snowden and the Rise of Whistleblower Culture» by Jill Lepore
«The New Yorker»: «Jonathan Ledgard Believes Imagination Could Save the World» by Ben Taub
«The New Yorker»: «Books: Susan Sontag and the Unholy Practice of Biography» by Janet Malcom
«The New York Review of Books»: «Our Lethal Air» by Jonathan Mingle
«The New York York Review of Books»: «Walter Gropius: The Unsinkable Modernist» by Martin Filler
«Columbia Review of Journalism»: «Is Facebook really concerned about privacy» by Himanshu Gupta
«Columbia Journalism Review»: «5 years ago, Edward Snowden changed journalism» by Pete Verson
«The Washington Post»: «President Trump and the warping of democratic governance» by Dan Balz
«The Washington Post»: «The completely correct guide to getting off a plane » by Natalie B. Compton
«The Guardian: «The long read: Why can’t we agree on what’s true anymore?» by William Davies
«The Guardian»: «Podcast – Justin Trudeau: the rise and fall of a political brand»
«The Guardian»: «Think only authoritarian regimes spy on their citizens?» by Kenan Malik
«The Guardian»: «Sicilians dare to believe: the mafia’s cruel regime is over» by Lorenzo Tondo
«The Guardian»: «Ultra by Tobias Jones review – Italian football and the far right» by Tim Parks
«The Observer»: «Are brain implants the futurte of thinking?» by Zoe Corbyn
«The Intercept»: «Why I Decided not to Delete My Old Internet Posts » by Edward Snowden
«Rolling Stone» : «Mitch McConnell: The Man Who Sold America» by Bob Moser
..........Kalenderwoche 38..........
«The New York Times»: «The World 9/11 Took From Us» by Omer Aziz
«The New York Times»: «Let Trump Destroy Trump» by David Axelrod
«The New York Times»: «Nonfiction: Inside the Minds of the Women Who Joined ISIS» by Anne Barnard
«The New York Times»: «How Fan Culture Is Swallowing Democracy» by Amanda Hess
«The New York Times»: «He Who Must Not Be Tolerated» by Kara Swisher
«The New York Times»: «The One Thing No Israeli Wants to Discuss» by Matti Friedman
«The New York Times»: «Robert Frank Dies; Pivotal Documentary Photographer was 94» by Philip Gefter
«The New Yorker»: «Annals of Diplomacy: The Logic of Humanitarian Intervention» by Dexter Filkins
«The New Yorker»: «Dept. Of Popular Culture – Superfans: A Love Story» by Michael Schulman
«The New Yorker»: «Personal History : My Terezín Diary» by Zuzana Justman
«The New Yorker»: «Robert Mugabe and the Fate of Democracy in Africa» by Robin Wright
«The New Yorker»: «Climate Change: What If We Stopped Pretending?» by Jonathan Franzen
«The New Yorker»: «The Shock of Robert Frank’s ‘The Americans’» by Peter Schjedahl
«The Washington Post»: «Afghanistan: Witness to a War» by Kevin Maurer
«The Washington Post»: «Israel and the decline of the liberal order» by Robert Kagan
«The Guardian»: « Podcast – « ‘It’s all gone’: how Hurricane Dorian devastated the Bahamas»
«The Guardian» : «Podcast: Siri, sex and Apple’s privacy problem»
«KENYONreview»: «Twelve Words» by Brian Trapp
«The Intercept»: «From Paso to Sarajevo» by Murtaza Hussain
..........Kalenderwoche 37..........
«The Guardian»: «Podcast : Reporting from the eye of a political storm»
«The Guardian»: «State of nomination: where do Democrats stand as 2020 narrows?» by Lauren Gambino
«The Guardian»: «Hong Kong: Will scrapping extradition bill end protests?» by Verma Yu
«The Guardian»: «A glimpse behind the scenes of Giza’s Grand Egyptian Museum» by Ruth Michaelson
«The Guardian»: «Podcast: The man who gave birth»
«The Guardian»: «Robert Mugabe killed the freedoms he had worked so hard for» by Fadzayi Mahere
«The New Yorker» : «Are Spies More Trouble Than They Are Worth?» by Adam Gopnik
«The New Yorker»: «Reader, I googled It» by Dan Chiasson
«The New Yorker»: «The Message of Measles» by Nick Paumgarten
«The New York Review of Books»: «Brexit. Fools Rush Out» by Jonatahan Freedland
«The New York Review of Books»: «The Streets of New York» by Phil Penman
«The New York Times» : «The ‘Political Anarchist' Behind Britain’s Chaos» by Jenni Russell
«The New York Times»: «Boris Johnson’s Do-or-Die Debacle» by Roger Cohen
«The New York Times»: «One Job Is Better than Two» by Binyamin Appelbaum & Damon Winter
«The New York Times»: «On the Job 24 Hours a Day, 27 Days a Month» by Andy Newman
«The New York Times»: «How to Manage Your Mental Illness at Work» by Eric Ravenscraft
«The New York Times»: «The Real Donald Trump Is a Character on TV» by James Poniewozik
«The Washington Post»: «Donald and the black sharpie» by Dana Milbank
«The Washington Post»: «Why America is losing the information war to Russia» by David Ignatius
«The Atlantic»: «The Man Who Couldn’t Take It Anymore» by Jeffrey Goldberg
..........Kalenderwoche 36..........
«The Observer»: «Into the storm: the horror of the second world war» by Neil Ascherson
«The Guardian»: «How far will China go to stamp out Hong Kong protests?» by Tania Branigan
«The Guardian» : «A civil war state of mind now threatens our democracy» by Polly Toynbee
«The Guardian»: «Margaret Atwood: ‘She’s ahead of everyone in the room’» by Johanna Thomas-Corr
«The Guardian»: «The long read: How the prison economy works» by Richard Davies
«The Independent» : «Trump is now the ‘crazed’ rogue leader in the US-Iran saga» by Robert Fisk
«The Washington Post»: «People have Trump fatigue. How will it effect 2020?» by David Ignatius
«The Washington Post»: «Why can’t we use nuclear weapons agaings bedbugs?» by Dana Milbank
«The Washington Post»: «A climate change solution slowly gains ground» by Steven Mufson
«The Washington Post»: «Teaching America’s Truth» by Joe Heim
«The Washington Post»: «Boris Johnson is taking British democracy to the brink» by Ishaan Tharoor
«The Washington Post»: «Much of the world can learn something fom Africa» by Fareed Zakaria
«The New Yorker»: «China’s Hong Kong Dilemma» by Evan Osnos
«The New Yorker»: «The Rich Can’t Get Richer Forever, Can They?» by Liaquat Ahamed
«The New York Times»: «What’s Next for Brexit? Six Possible Outcomes» by Stephen Castle
«The New York Times» : «The Amazon, Siberia, Indonesia: A World of Fire» by Kendra Pierre Louis
«The New York Times» : «Donald Trump Has Worn Us All Out» by Frank Bruni
«The New York Times» : «Italy’s New Marriage of Convenience» by Bepe Servergnini
«The New York Times»: «Trump’s Twitter War on Spelling» by Sarah Lyall
«The New York Times»: «Waiting for the Monsoon, Discovering a Brain Tumor Instead» by Rod Nordland
«The New York Times»: «Nonfiction: The Women’s Revolution in Politics» by Kate Zernike
«The New York Times»: «Nonfiction: The Truth About Koch Industries» by Bryan Burrough
«The New York Times Style Magazine» : «Utopia, Abandoned» by Nikil Saval
«Rolling Stone»: «Trump 2010. Be Very Afraid» by Matt Taibbi
«Rolling Stone»: «The Very Real Possibility of President Elizabeth Warren» by Jamil Smith
«Outside»: «The Tragedy on Howse Peak» by Nick Heil
..........Kalenderwoche 35..........
«The New York Times»: «China’s Soft Power Failure: Condemning Hong Kong’s Protests» by Li Yuan
«The New York Times»: «The People’s War Is Coming to Hong Kong» by Yi-Zheng Lian
«The New York Times»: «The World Has a Germany Problem» by Paul Krugman
«The New York Times»: «Trump. Greenland, Denmark. Is This Real Life?» by The Editorial Board
«The New York Times»: «America the Beautiful» by Bret Stephens
«The New York Times»: «Some Migratory Birds Sleep Better Than Others» by Emily Anthes
«The New York Times Magazine»: «Neil Young’s Lonely Quest to Save Music» by David Samuels
«The New Yorker»: «A Reporter At Large: Silicon Valley’s Crisis of Conscience» by Andrew Marantz
«The New Yorker»: «Profiles: Mike Pompeo, The Secreatry of Trump» by Susan B. Glasser
«The New Yorker»: «The Failure to See What Jeffrey Epstein Was Doing» by Amy Davidson Sorkin
«The Washington Post»: «The 1619 project and the far-right fear of history» by Ishaan Tharoor
«The Washington Post»: «I was wrong about Trump. Here’s why» by Anthony Scaramucci
«The Washington Post»: «The U.S. must take Greenland by force!» by Dana Milbank
«The Washington Post»: «Trump’s idea of buying Greenland is far from absurd» by Marc A. Thiessen
«The Washington Post»: «The Amazon is burning» by Terrence McCoy
«The Guardian»: «The next global recession will be immune to monetary solutions» by Nouriel Roubini
«The Guardian»: «Molotov-Ribbentrop: why is Moscow trying to justify Nazi pact?» by Andrew Roth
«The Independent»: «The Fourth Afghan War is about to escalate» by Robert Fisk
«The Atlantic»: «The Great Land Robbery» by Vann R. Newkirk II
«Columbia School of Journalism»: «How conservative media has grown under Trump» by Howard Polskin
«Vanity Fair»: «No one is safe: how Saudi Arabia makes dissidents disappear» by Ayamn M. Mohyeldin
..........Kalenderwoche 34..........
«The Washingtgon Post»: «Trump has one playbook, and very few plays left in it» by Dan Balz
«The Washington Post»: «How not to fix Silicon Valley» by Paul Musgrave
«The Washington Post»: «In God’s country» by Elizabeth Bruenig
«The New York Times»: «If You Think Trump Is Helping Israel, You’re a Fool» by Thomas L. Friedman
«The New York Times»: «How to Torture Trump» by Gail Collins
«The New York Times»: «The Phony Patriots of Silicon Valley» by Kevin Roose
«The New York Times Magazine» : «The Undemocratic Impulses of American Democracy» by Jamelle Bouie
«The New York Times Magazine»: «Why Is Everyone Always Stealing Black Music» by Wesley Morris
«The New Yorker»: «The Political Scene: Stacy Abrams’s Fight for a Fair Vote» by Jelani Cobb
«The New Yorker»: «Personal History: A Year Without a Name» by Cyrus Grace Dunham
«The New Yorker»: «What Toni Morrison Understood about Hate» by David Remnick
«The Guardian»: «Podcast: the crisis in Kashmir»
«The Guardian»: «What do the Hongkong protesters want?» by Alison Rourke
«The Guardian»: «Grass Ski Championship in Pictures» by Alexandra Wey
«The Guardian»: «‘In many ways, it was a miracle’: looking back at Woodstock at 50» by Rob LeDonne
«The Observer»: «Hong Kong’s dilemma: fight or resist peacefully?» by Lily Kuo
..........Kalenderwoche 33..........
«The New York Times»: «The Global Machine Behind the Rise of Far-Right Nationalism» by Jo Becker
«The New York Times»: «Toni Morrison’s Song of America» by Tracy K. Smith
«The New York Times»: «Requiem for White Men» by Maureen Dowd
«The New York Times Magazine»: «The Schoolteacher and the Genocide» by Sarah Topol
«The New Yorker»: «Annals of Inquiry: Why Doctors Should Organize» by Eric Topol
«The New Yorker»: «Battleground America» by Jill Lepore
«The New Yorker»: «How Mosquitoes Changed Everything» by Brooke Jarvis
«The New York Review of Books»: «The Supreme Court: Keeping Up Appearances» by David Cole
«The New York Review of Books»: «Climate Change: Burning Down the House» by Alan Weisman
«The New York Review of Books»: «The Daily Alchemy of Translation» by Jennifer Croft
«The Washington Post»: «Have followers, will travel» by Elizabeth Chang
«The Atlantic»: «White Nationalism’s Deep American Roots» by Adam Serwer
«The Atlantic»: «I’ve seen the limits of journalism» by John Temple
«The Guardian»: «Kibera: ’There’s a lot of weirdness in a slum’» by Tracy McVeigh & Rod Austin
«The Guardian»: «’I don’t smell’: Meet the people who have stopped washing» by Amy Fleming
«The Guardian»: «The Californians forced to live in cars and RVs» by Vivian Ho
«The Guardian» : «Ahead of the pack: the best books about running» by Ben Wilkinson
«The Guardian»: «How the media contributed to the migrant crisis» by Daniel Trilling
«The Observer»: «‘His conduct left an impression that lingered’ : the life of Jeffrey Epstein»
...........Kalenderwoche 32..........
«The New York Times»: «We Have a White Nationalist Terrorist Problem» by The Editorial Board
«The Washington Post»: «Trump makes it all worse. How it could be different» by Editorial Board
«The Washington Post» : «Media’s coverage of gun-massacres must change» by Margaret Sullivan
«The New York Times»: «1969: It’s the Anniversary of Everything» by Alyson Krueger
«The New York Times»: «The Who-Can-Beat Trump Test Leads to Kamela Harris» by Roger Cohen
«The New York Times»: «Marianne Williamson Knows How to Beat Trump» by David Brooks
«The New York Times»: «Older Women: They’re Mad as Hell» by Ruth La Ferla
«The New Yorker»: «Annals of Law: Alan Dershowitz, Devil’s Advocate» by Connie Bruck
«The New Yorker»: «Dept. Of Finance: The Invention of Money» by John Lanchester
«The New Yorker»: «Books: What P.T.Barnum Understood About America» by Elizabeth Colbert
«The New York Review of Books»: «Real Americans» by Joseph O’Neill
«The Intercept»: «Mike Pompeo Is Donald Trump’s De Facto Intelligence Czar» by James Risen
«The Guardian»: «No-deal Brexit was once a sick Tory joke. Not it’s serious» by Simon Jenkins
«The Guardian»: «The long read: How the state runs business in China» by Richard McGregor
«The Guardian»: «Living without water: the crisis pushing people out of El Salvador» by Nina Lakhani
«The Guardian»: «’He’ll reap what he sows’: What does Baltimore make of Trump?» by David Smith
«The Guardian»: "Ken Burns on America: ‘We’re a strange and complicated people’" by Mark Lawson
«Rolling Stone» : «The Iowa Circus» by Matt Taibbi
..........Kalenderwoche 31..........
«The Washington Post»: «Mueller didn’t fail. The country did» by Jennifer Rubin
«The Washington Post»: «A weary old man with a warning» by Paul Zak & Jada Juan
«The Intercept»: «Rainforest on Fire» by Alexander Zaitchick
«The New York Review of Books»: «The Ham of Fate» by Finton O’Toole
«The New York Review of Books»: «Iran: The Case Against War» by Steven Simon & Jonathan Stevenson
«The New York Review of Books»: «A Long & Undeclared Emergency» by Pankaj Mishra
«The New Yorker»: «Why Facts Don’t Change Our Minds» by Elizabeth Colbert
«The New Yorker»: «Books: Rediscovering Natalia Ginzburg» by Joan Acocella
«The New York Times» : «Brexit Under Boris Johnson: Deal or No Deal?» by Richard Pérez-Peňa
«The New York Times»: «Why I’m Rooting for Boris Johnson» by Bret Stephens
«The New York Times»: «Trump Impeachment Is Far Less Likely After Muller Testimony» by Carl Hulse
«The New York Times»: «Trump’s Inumanity Before a Victim of Rape» by Roger Cohen
«The New York Times»: «This Is an Article About Women» by Nicola Pardy
«The New York Times»: «‘They’re doing it as we sit here’» by The Editorial Board
«The New York Times»: «Honduras: Pay or Die » by Sonja Nazario (text) & Victor J. Blue (photos)
«The Guardian»: «The disinformation age: a revolution in propaganda » by Peter Pomerantsev
«The Conversation»: «The internet is rotting – let’s embrace it» by Viktor Mayer-Schönberger
Nichts ist so gut wie Ziegenhaar
Die bekundete Version lautete, sie seien aus Versehen im Iglu liegen geblieben. Den Gesichtsausdruck des Materialwartes habe ich nicht mehr präsent, es ist ja ein halbes Jahrhundert her. Ich vermute, dass er den Kopf schief legte, ein Auge zukniff und mich mit dem anderen scharf fixierte. Wir wussten beide, dass es gelogen war. «Hier unterschreiben», sagte der Materialwart. Das war 1968 im Keller einer Kompanie des Gebirgsjägerbataillons in Mittenwald, nicht weit von der österreichischen Grenze. Ich hatte meine zwei Jahre absolviert und liess bei der Entlassung die wunderschönen Seehundfelle mitgehen. Es ist zu hoffen, dass die Straftat verjährt ist.
Sie waren von einem sehr hellen Braun, aufgenäht auf eine Unterlage aus dickem Segeltuch. Man hängte sie mit einer Schlaufe an den Skispitzen ein und befestigte sie hinten mit einer Spannvorrichtung. In der Mitte hatten sie eine kleine Metallschiene, die wurde in den Kopf einer Schraube eingeführt, die man in der Skimitte herausdrückte. Mit Hilfe einer Feder schnappte die Schraube zurück und hielt so das Fell unter dem Ski fest. Rein ästhetisch gesehen waren die Robbenfelle ein alpinistisches Schmuckstück, ihr Gebrauch hingegen war eine Plackerei sondergleichen. Denn natürlich bildeten sich Klumpen von Schnee zwischen Ski und Fell, und Ersatzfelle waren obligatorisch, weil öfter mal ein Fellriemen riss.
Alpinismus ist aus dem Handwerk entstanden
Man sagt, der Alpinismus sei in seinen Anfängen eine Erfindung aristokratischer Briten gewesen, aber was hätten sie gemacht ohne die einheimischen Handwerker? In seiner Geschichte des Bergsteigens mit dem treffenden Titel, «Der Träger war immer schon vorher da», nimmt Martin Krauss die Ideologie des alpinen Heldentums auseinander. Ohne die Hilfe von Bauern und Bäuerinnen, Gemsjägern, Hirten, Sennerinnen, Saumtreibern, Schmugglern und Schmieden wäre kein einziger der Gentlemen zum Gipfel gekommen. Denn Bergsteigen entstand von alters her aus dem Handwerk:
«Seile gab es, um Schafe, Ziegen und Rinder sicher ins Tal zu bringen. Steigeisen wurden verwendet, um an steilen Hängen zu mähen oder auf Eisfeldern der Jagd nachzugehen (…) Die ersten städtischen Bergtouristen waren oft fasziniert von dem, was Gemsjäger und Hirten konnten.» (Krauss, S. 16)

Am 11. Dezember hat die Unesco den Alpinismus in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Bergführerverbände und Alpenclubs in Frankreich, Italien und der Schweiz hatten sich dafür stark gemacht. Das Bundesamt für Kommunikation schreibt, die Unesco wolle damit «ein Kulturerbe thematisieren und schützen, das weniger mit Bauten und Räumen zusammenhängt, sondern in erste Linie mit gemeinschaftlichen Praktiken und gesellschaftlichen Interaktionen».
Denn der Alpinismus sei «geprägt von einer gemeinsamen Kultur, von geteilten Kenntnissen über die Geschichte der Praktik selbst und ihrer Werte». Da gehe es nicht zuletzt um Kenntnisse über Technik und Sicherung des Aufstiegs und die Verwendung des Materials.
Die Erfindung der Haftfelle
Beim Klettern wie beim Skibergsteigen war das Material stets ein Schlüsselfaktor. Dass das «Skitouring» in den letzten Jahrzehnten ein Massensport wurde, wäre ohne die Entwicklung der Steigfelle unmöglich gewesen. Die bahnbrechende Wende kam in der Schweiz 1968. In dem Jahr gab es nicht nur die erste Mondlandung und Studentenrevolten, die einen kulturellen Umbruch einleiteten, sondern auch eine Zeitenwende im Alpinismus: nämlich die Erfindung von selbsthaftenden Skifellen. Erfunden hat sie Hans Fischli im Kanton Glarus, und er liess sie auch bald patentieren.
Fischli hatte Schuhmacher gelernt, sich aber Ende der vierziger Jahre auf die Produktion von Kletterrucksäcken und Skistöcken aus Metall spezialisiert. Er war selbst passionierter Bergsteiger und Kletterer. Im Kanton Glarus war schon 1893 der erste Skiclub gegründet worden. Das Skifahren hatte sich von Skandinavien aus in den Alpenländern ausgebreitet. So ist es wohl auch zu erklären, dass die ersten Steigfelle aus Seehundfell gefertigt waren.
Der Gebrauch von Fellstreifen zum Aufstieg mit Skiern war schon um 1900 bekannt. Das grosse Problem war, dass sie mit Riemen schlecht am Ski hielten. Auch der Gebrauch von Klebwachs war keine Lösung, denn wenn man auf dem Gipfel die Felle abnahm, musste man den Wachs mühsam vom Skibelag abkratzen.
«Mein Vater hat Jahre lang gepröbelt, bis er es schliesslich geschafft hat, einen Leim zu entwickeln, der am Textil haften blieb, aber nicht an den Skiern», erzählte mir vor ein paar Jahren Werner Fischli, damals noch Chef und Inhaber der Firma Colltex in Glarus. Colltex ist aus der Tödi Sport AG von Hans Fischli hervorgegangen und gehört heute zu den Marktführern unter den Herstellern von Skifellen.

Die Erfindung der Haftfelle war eine Revolution. Nicht nur die Alpinistinnen und Alpinisten erkannten schnell die Vorteile der neuen Technik, auch die Schweizer Armee rüstete Gebirgstruppen mit dem Selbstklebefell aus. Für Hans Fischli und seine Tödi Sport AG war das der Take-off.
Colltex war indessen nicht lange allein auf dem Markt. Das Klebefell setzte sich im Handumdrehen im ganzen Alpenraum und in den USA durch. Heute hat der US-Hersteller Black Diamond eine starke Marktposition, aber auch die Westschweizer Pomoca sowie die österreichischen Firmen Fischer, Contour, Gecko und andere sind im Geschäft mit den Skifellen.
Mohair: die wunderbare Naturfaser
Prinzipiell hat sich im Lauf eines halben Jahrhunderts wenig geändert am Aufbau der Felle. Sie bestehen aus einer polyesterverstärkten Baumwollzwischenlage, der mit dem Fasergewebe (Fellflor) zusammengepresst wird. Auf die Rückseite kommt dann die Haftschicht, die am Ski aufliegt. Der Flor besteht aus Synthetikfasern (meist Polyamid) oder aus Mohair, der Wolle der Angora-Ziege.
Das Erstaunliche dabei ist, dass es trotz der enormen Entwicklung der Kunststoffe bis heute nicht gelungen ist, ein Skifell zu produzieren, dass es mit den Vorzügen der Naturfaser Mohair aufnehmen kann. Mohair ist stark resistent gegen Feuchtigkeit und bleibt auch bei grosser Kälte geschmeidig. Die Gleiteigenschaften reiner Mohairfelle sind besser als die von synthetischen Fasern. Die Athleten der „Patrouille des Glaciers“, eines der weltweit härtesten Skitouren-Rennen, benutzen nach wie vor oft Haftfelle aus reinem Mohairgewebe.
Bei den Klebern wurde und wird viel experimentiert. Der Leim, den Hans Fischli erfand, war ein Harzkleber, also ein Naturprodukt. Im heutigen Jargon der Hersteller spricht man von Hotmelt Adhesion. Vor ein paar Jahren kam dann das „Fell ohne Kleber“ auf den Markt, die Acrylate Adhesion. Sie funktioniert mit einer kleberlosen Haftschicht auf Silikon Basis. Die Moleküle richteten sich auf Druck anders aus und dadurch entstehe die Haftung, so wurde mir schon vor Jahren erklärt, und ich habe es bis heute nicht recht verstanden.

Der Vorteil dieser Felle ist, dass man sie mit den Klebeflächen einander legen kann, ohne die lästigen Kunststoffnetze dazwischen zu legen, was bei Sturm auf einem Gipfel eine mühsame Übung ist.
Bei Colltex hat man aber von dem reinen Silikonkleber schnell wieder Abstand genommen. Hans-Peter Brehm, Bergführer und seit zwei Jahren Colltex-Chef, sagt: «Wir haben jetzt noch das Acrylat, das ist auch auf einer Silikon-Basis, aber nicht rein, sondern es ist ein Mix. Man kann es ohne Netz verwenden. Was da aber der Nachteil ist: Wenn man ein paarmal auf- und abfellt und es ist vielleicht feucht und das Fell wird nass, dann kann es sein, dass es nicht mehr so gut klebt. Für Spezialisten, die wissen, wie man damit umgeht, ist es super, aber für die breite Masse der Skitourer ist es nicht so gut.»
Brehm sieht die Probleme der Zukunft weniger beim Leim als beim Flor:
«Die Mohairwolle kommt aus Südafrika. Die Beschaffung ist teilweise problematisch. Denn das Material wird auch in der Möbelindustrie gebraucht, die Chinesen kaufen sehr viel, die Preise steigen und wir haben tendenziell keine Versorgungssicherheit. Natürlich auch beim Mix-Fell, wo man 70 bis 80 Prozent Mohair drin hat und noch Synthetik, dass es etwas stabiler und langlebiger wird.»
Colltex habe deshalb kürzlich ein Patent auf ein reines Synthetik-Fell anmelden können. Synthetik-Fasern gleiten nicht so gut. Daher habe man eine ganz neue Technologie entwickelt, um die Gleiteigenschaften zu verbessern. Und wie soll das funktionieren? «Wird nicht verraten», sagt Brehm, «Betriebsgeheimnis.»
Letzten Sommer habe ich die alten Felle aus Mittenwald in die Zürcher Verbrennungsanlage Hagenholz gebracht. Zusammen mit einem Haufen geschichtsträchtigen Alpinwerkzeugs: uralte Steigeisen, löchrige Segeltuchgamaschen, bleischwere Vollmetall-Eispickel, abgenutzte 12-mm-Seile und Tourenskier von zwei Metern Länge, die heutige Cracks wohl als «Spaghetti» bezeichnen. Es war ein Transport mit schwerem Herzen, die Entsorgung eines alpinistischen Curriculums und seiner Fetische.
Aber wenn auch Faulkner schrieb, die Vergangenheit sei nie tot, sie sei nicht einmal vergangen, so kann ich doch sagen: Jetzt hab ich endlich mehr Platz im Keller. Für die verschiedenen neuen Tourenski und die Mohair-Felle mit Hotmelt Adhesion.
Denn wie man sieht: Das «immaterielle Kulturerbe» bringt ganz schön viel Material hervor.

Das unentrinnbare Fest
Weihnachten ist nicht umzubringen. Es ist die konkurrenzlos wichtigste Festzeit des Jahres und zeigt keinerlei Abnützungserscheinungen. Ob es sich dabei tatsächlich um eine im Kern religiöse Angelegenheit handelt, ist ziemlich unklar. Genau diese Unklarheit ist das Erfolgsgeheimnis des Phänomens namens Weihnachten. Und dies nicht erst in neuerer Zeit, sondern seit der Erfindung des Geburtsfests Christi.
Vom Sol invictus zum Pantokrator
Weihnachten ist jünger, als man vermuten könnte. Das Fest ist eine Innovation des 4. Jahrhunderts. Das im Römischen Reich zuerst lange unterdrückt gewesene Christentum avancierte damals unter Kaiser Konstantin zur Staatsreligion und begann unverzüglich, den Spiess umzudrehen und Anhänger anderer Kulte zu bedrängen. Um den Status als herrschende Religion zu untermauern, wurde der zur Wintersonnenwende gefeierte, damals noch junge Kult des Sol invictus (des unbesiegten Sonnengottes) kurzerhand mit einem unfriendly takeover umgewandelt zum christlichen Geburtsfest.
Mit der Symbolik des nach der längsten Nacht wieder zunehmenden Lichts bot das Sol-invictus-Fest den idealen Rahmen für eine Feier der christlichen Heilsvorstellung. Der astronomische Übergangspunkt des tiefsten Sonnenstands, nach dessen Durchgang das Tageslicht wieder zunimmt, stimmte überein mit der christlichen Vorstellung, mit der Geburt Jesu sei eine alles zum Guten verändernde Zeitenwende in die Welt gekommen.
Indem die christliche Kirche unverhofft in den Rang der Staatsreligion erhoben war, bekam diese heilsgeschichtliche Vision plötzlich einen eminent machtpolitischen Gehalt. Die christliche Lehre bestimmte fortan autoritativ den grossen gedanklichen Rahmen, in den sich alles zu fügen hatte.
Die Mitte der Zeiten, so die weit ausgreifende theologische Spekulation, war gesetzt mit der Geburt des Gottessohnes. Von dieser Mitte aus gesehen war die Zukunftserwartung der Menschen ausgerichtet auf die Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten. Mit ihr würde das schon in der Schöpfung angelegte Ziel einer universellen Erlösung erfüllt. Das Weihnachtsfest proklamierte als regelmässig im Jahresverlauf verorteter Kult die unverrückbare Gültigkeit dieser «grossen Erzählung» und die daran hängende Macht der christlichen Kirche.
In der liturgischen und frömmigkeitspraktischen Ausprägung stand der Machtaspekt allerdings nicht im Vordergrund, ja, er war vermutlich den meisten Angehörigen der Kirche nicht einmal bewusst. Wurde Christus als der Pantokrator, der alles Erschaffende, dargestellt und entsprechend gefeiert und angebetet, so äusserten die Gläubigen damit Verehrung und unbedingtes Vertrauen in die in Aussicht gestellte Erlösung.

Den mitenthaltenen Machtanspruch, der über die Kirche und ihre Gemeinschaft hinausreichte, dürften die Beterinnen und Beter kaum wahrgenommen haben. Er war aber hintergründig präsent als durchaus nicht rein religiöse Vorstellung. Eine gewisse Unklarheit der Intention war also vom Ursprung her in dieses «Fest der Mitte der Zeiten» eingepflanzt.
Genetisch auf Plastizität programmiert
Lebendige Kulturen und Kulte zeigen à la longue fast immer eine Eigenschaft, die besonders in der Biologie bekannt ist: Plastizität. Dank ihrer Formbarkeit passen kulturelle Manifestationen sich an wechselnde Bedingungen und Einflüsse an. Und obschon sie ihre Inhalte und Formen auf diesem Weg oft in sehr starkem Mass verändern, werden sie doch als Kontinuitäten wahrgenommen, die ihre Identität beibehalten.
Das Weihnachtsfest ist das Paradebeispiel eines Kulturphänomens von hochgradiger Plastizität. Sein genuin unklares Gemisch aus biblischen, frömmigkeitspraktischen, theologisch-spekulativen und machtpolitischen Komponenten hat diesem Fest sozusagen die genetische Ausstattung für stets neue und ausserordentlich erfolgreiche Anpassungen an veränderte Umstände mitgegeben.
Man kann nur staunen, zu welch breitem Spektrum an Mutationen diese Anpassungsfähigkeit geführt hat. Die kulturell, konfessionell und auch kalendarisch unterschiedlichen Weihnachtszyklen bilden heute das globale Fest par excellence. Das Erstaunlichste dabei ist nicht einmal so sehr die enorme Diversität an Brauchtum, die sich weltweit um das religiöse Fest gebildet hat.
Mehr noch beeindruckt die Plastizität des Weihnachts-Clusters bei der Anpassung an andersreligiöse und nichtreligiöse Umfelder. So ist etwa in der islamischen Welt das Weihnachtsfest als Feier der Lichter und des Schenkens weithin höchst populär, und dies trotz der erstarkten islamistischen Strömungen, die darin eine zu verurteilende Verwestlichung erblicken.
Ein ähnliches Weihnachten ohne traditionell christliche Bezüge funktioniert auch im Westen ganz hervorragend. Die Symboliken des Festes sind problemlos übersetzbar in ein vages zivilreligiöses Wertemuster des Friedlichen, Besinnlichen und Gemeinschaftlichen. Lichterglanz und Weihnachtsschmuck heben die Festzeit aus dem Alltag heraus, Geschenke signalisieren Zuwendung. Das alles braucht keinen religiösen Über- oder Unterbau.
Mutation zum Subversiven
Selbst unter Bedingungen offizieller Zurückweisung christlicher Gehalte ist dem Fest die Vitalität nicht zu nehmen. Stalin sah sich 1937 gezwungen, für das von den Bolschewisten mit dem Revolutionskalender abgeschaffte Weihnachtsfest einen Ersatz zu bieten: das Jolka, ein Tannenfest, dessen weihnächtliche Aspekte man zwar offiziell leugnen, aber dennoch nicht völlig unterdrücken konnte.
Aus der DDR ist überliefert, dass die als öffentliche Weihnachtssymbole tabuisierten Engel angeblich in «Jahresendflügelfiguren» umbenannt wurden. Es ist allerdings laut Wikipedia nicht ganz geklärt, ob das Wort eine Parodie der von der Partei verordneten Sprache war oder ob es tatsächlich ernst gemeint war. So oder so, im kommunistischen Machtbereich war die Weihnacht aus der Öffentlichkeit verbannt und trotzdem unübersehbar anwesend. Die Zensurierung alles explizit Christlichen hat dies nicht verhindert. Die Plastizität des Weihnachtsfests hat auch Mutationen zum Subversiven hin möglich gemacht.
Anders liegen die Dinge beim Bannstrahl der multikulturellen Korrektheit, welcher das öffentliche Zelebrieren oder nur schon Benennen der Weihnacht in den USA und deren direktem Einflussbereich unter Kuratel stellt. So werden statt Grussbotschaften und Segenswünschen zu Weihnachten «Seasons greetings» ausgetauscht, um ja keine Adressaten zu vergraulen, die nicht christlich orientiert sind.
Das hindert die Amerikaner aber nicht daran, den öffentlichen Raum extensiv mit Insignien des Christfests zu überziehen. Die Präsentationen des gigantischen Christmas Tree beim Rockefeller Center in New York (Bild ganz oben) und der Weihnachtsdekoration im Weissen Haus (bekanntlich die Domäne der jeweiligen First Lady) werden alljährlich als vorweihnächtliche Ereignisse zelebriert, die mit einer allgemeinen Eruption des Lichterzaubers und des Schmückens im Land einhergehen.
Frei flottierende Gefühligkeit
Symbolik und Betriebsamkeit des Weihnachtsfests erzeugen weltweit ein Amalgam von Mega-Event, Geschäft und Emotionalität, das eine Art Ausnahmezeit heraufbeschwört. Diese Festperiode, obschon in ihrem Wesen völlig säkularisiert, übernimmt vom religiösen Kult die Gefühlswelt des Angerührtseins von «etwas Grösserem», ohne dieses zu benennen oder bewusst zu intendieren. Der Umstand, dass sie frei flottiert, macht die weihnächtliche Gefühligkeit unkontrollierbar und erst recht potent.
Emotionalität in Verbindung mit inhaltlicher Unklarheit machen wie eh und je die Unwiderstehlichkeit des Festes aus. Diese genuinen Eigenschaften prädestinieren das Weihnachtsfest nicht zuletzt für seine Nähe zum blossen Effekt, auch Kitsch genannt. Denn dieser ist, folgt man der berühmten Definition Richard Wagners aus seiner Kritik an den Opern Meyerbeers, nichts anderes als «Wirkung ohne Ursache».
Angewendet auf unseren Fall: Wegen seiner inhaltlichen Unbestimmtheit erzeugt das globalisierte Weihnachten so etwas wie Emotion ohne Anlass. Das dürfte der Grund sein, weshalb die Wirkungen des Weihnachtsfests auch für diejenigen unentrinnbar sind, die am liebsten gar nichts mit ihm nichts zu tun haben wollen.
Individuelle Anpassungen
Es soll ja nicht wenige Menschen geben, die unter der Weihnacht leiden und sich deswegen – mit unsicherem Erfolg – dem Rummel zu entziehen suchen. Andere schliessen mit dem unentrinnbaren Fest ihren Frieden, indem sie es für sich ausblenden, so gut es eben geht, und sich im Übrigen an Einzelheiten halten, an denen sie sich zu freuen vermögen. Wieder andere packen den Stier bei den Hörnern, indem sie die Sache durchziehen mit konsequenter Befolgung familiärer Weihnachtstraditionen und dabei keine Zweifel zulassen, dass dies das Schönste überhaupt sei.
Kraftakte, wohin man schaut: Vermeidung, Arrangement oder Flucht nach vorn. Doch mit diesen eher anstrengenden Arten des Umgangs mit dem unvermeidlichen Fest ist das Repertoire der Möglichkeiten, Weihnachten zu feiern oder zu überleben, glücklicherweise nicht ausgeschöpft. Das Prinzip der Plastizität funktioniert nicht nur bei der Geschichte und weltweiten Ausbreitung der Weihnachtstradition, sondern auch bei denen, die das Fest begehen oder ihm ausgesetzt sind.
Der globale Weihnachtsrummel hat die Qualität einer allgemeinen temporären Weltveränderung. Man passt sich an sie an wie an ein Wetterphänomen und benutzt dabei eine Auswahl vorgeprägter Verhaltensmuster sowie eigene, individuelle Strategien. So können denn Gläubige und Agnostiker, Skeptische und Experimentierende, Begeisterte und Genervte, Traditionalisten und Zeitgeist-Surfer sich individuell auf Weihnachten einstellen und nach Gusto und Gelegenheit Einzelnes von diesem Cluster an sich heranlassen: Kindheitserinnerungen, Momente der menschlichen Nähe, liebgewordene Rituale, vertraute Gerüche, das «Friede auf Erden!», berührende Lieder, altvertraute Geschichten, grosse Musik und – warum nicht? – ein bisschen Kitsch. Sie legen sich damit auf nichts fest, sondern bleiben im Unbestimmten, und gerade so bewegen sie sich auf der Höhe des Lichterfests, das uns Jahr für Jahr heimsucht und, wenn wir mitspielen, erfreut.
In diesem Sinn: entspannte Weihnachten!

Es ist die Hölle. Nein, es ist Weihnachten
Ein krächzender Kinderchor empfängt mich. Über die Lautsprecher dröhnt: „Leise rieselt der Schnee“. Warum auch so laut?
Hunderte kaufen jetzt ein, vielleicht sind es gar Tausende. Die meisten sind ungeduldig, ungehalten. Viele sind unfreundlich, mit den Nerven am Ende: ein Vorweihnachtstag. Jetzt: „Jingle bells, jingle bells, jingle all the way“. Die Version von Frank Sinatra. Ich ertrage das Stück seit Jahren nicht mehr.
Ich weiss, man sollte nicht kurz vor Weihnachten einkaufen. Babys schreien, hilflose Mütter, überforderte Väter. Man drängt sich durch die Menge, ein Einkaufswagen rammt einen anderen. „Können sie nicht aufpassen!“ Jetzt: „Süsser die Glocken nie klingen“. Schnulzige, amerikanisierte Schmachtfetzen, und warum so laut!
Vor dem Joghurt-Gestell ein Drama. Ein kleiner Junge schreit, die Mutter schreit zurück. Er soll sich endlich benehmen, sagt sie. Dazu: „... alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar...“. Der Kleine ist wütend, nimmt einen Joghurt aus dem Regal und schmeisst ihn mit voller Wut auf den Boden. Der Becher zerbricht, überall griechischer Joghurt mit Honig-Geschmack. Aufruhr, die Mutter schreit, der Kleine schreit noch lauter. Der Vater grinst. Wie gerne wäre er jetzt im Büro. „... holder Knabe im lockigen Haar...“. Ich flüchte in die Käse-Abteilung.
Dort verliert sich ein junger Mann im französischen Käseangebot. Jetzt dröhnt: „Oh Tannenbaum“. Der junge Mann, vermutlich ein Deutscher, summt mit. Doch nicht, wie es sich gehört. Er summt „Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, die Oma steckt im Kofferraum.“ Immerhin einer ist entspannt. Er entscheidet sich für einen „Galet de la Loire“-Käse.
Jetzt eine rachitische Sopranistin: „Es ist ein Ros‘ entsprungen“. Diese Musik tut weh. Man könnte die Wände hinaufgehen. Triefender Herz-und-Schmerz-Kitsch. Täusche ich mich oder wird diese Musik jetzt immer lauter? Irgendetwas zieht sich in mir zusammen. Als ob eine Kreide auf einer Wandtafel quietschte.
Die Leute können kaum miteinander sprechen, sie schreien, um die Musik zu übertönen. „...oh Jesu bis zum Scheiden aus diesem Jammertal...“ Horror, Albtraum. Ich möchte den Kerl vor mir haben, der diese Musik so laut stellt.
Ein Mädchen, drei oder vier Jahre alt, sitzt im Einkaufswagen. Aus einem aufgerissenen Paket isst sie Paprika-Chips. „Leise rieselt der Schnee“, leiert ein gefühlsdusliger Bariton, „...still und starr liegt die See...“ Jetzt spielt ein Mädchen Hänsel und Gretel. Sie verstreut die Chips auf dem Boden, um den Weg zu markieren. Der Vater kniet nieder und liest sie zusammen. Die Mutter bellt den Vater an, weil er der Kleinen erlaubt hat, das Paket schon jetzt zu öffnen. „...weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, Christkind kommt bald“. Es schaudert mich.
Vor der Metzgerei wartet ein Dutzend Menschen. Auch ich warte. Plötzlich tauchen zwei Mädchen auf, etwa 16 Jahre alt, ungewaschene Haare. Sie halten ein Plakat hoch. „Fleischfresser, Mörder“. Offenbar spielen sie Greta Thunberg. Vielleicht hoffen sie, verhaftet zu werden und in der Zeitung zu landen. Und jetzt: „I’m dreaming of a white Christmas“, die Version von Bing Crosby. Jetzt skandieren die Mädchen: „Mörder, Mörder“. Kaum jemand nimmt sie zur Kenntnis. Sie eignen sich nicht als Greta Thunberg. Sie landen nicht in der Zeitung. Trotzdem taucht ein Verantwortlicher des Supermarkts auf und führt die beiden zum Ausgang. „...may your days be merry and bright“. Jetzt ist wohl nicht der Augenblick, dem Verantwortlichen zu sagen, er solle endlich diese schauderhafte Musik abstellen.
Den Metzger kenne ich. Als ich endlich an der Reihe bin und mein Ossobuco kaufen kann, wie er diesen Cauchemar aushält. Er lächelt diplomatisch: „Da müssen wir alle durch.“
Die Gemüse-Abteilung: Frischer Spinat, frischer Fenchel. „Kling, Glöckchen, klingelingeling“. Es ist nicht zum Aushalten. Dieser melodramische Kitsch soll wohl die Kunden in eine vorweihnachtliche Stimmung lullen, damit sie mehr einkaufen. Bei mir geschieht das Gegenteil: Ich will so schnell wie möglich flüchten. Ohne dieses Hühnerhaut produzierende Geplärre hätte ich wohl viel mehr gekauft.
Vor dem Teigregal spricht mich eine alte Frau an. Deutsch kann sie kaum. Sie streckt mir ein Paket Blätterteig entgegen. Sie will von mir wissen, ob dieser Teig rund oder rechteckig sei. Ich habe wenig Erfahrung in Sachen Blätterteig. „Lesen sie!“ fordert mich die Frau auf. Ich lese, finde aber nichts. „Hier steht nichts“, sage ich. „Natürlich steht etwas“, sagt die Frau forsch. „Können sie nicht lesen, sind sie nie zur Schule gegangen.“ Schon wieder „freue dich, Christkind kommt bald“, diesmal eine gepopte Version, begleitet von zirpenden Geigen.
Ich kämpfe mich zur Kasse durch. Doch der Weg dorthin ist weit. „Hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.“ Kommerzialisierte, bigotte, scheinheilige Religiosität. Es tut weh, nicht nur in den Ohren. Der ganze Körper sträubt sich.
Endlich die Kasse. Ich frage die Kassiererin, wie es ihr geht. Nein, ich frage nicht, ich schreie, Nur so übertöne ich den Schmalz, der aus dem Lautsprecher trieft: „Geht es ihnen gut?“ Sie lächelt mich an. Mit ruhigem Balkandeutsch sagt sie: „Weihnachten ist das Fest der Liebe“. Na denn.
Jetzt endlich ist der Fluchtweg frei. Es ist die Hölle hier. Nein es ist Weihnachten.
P.S. Nach der Flucht aus dem Supermarkt stehe ich im Stau. Hunderte Autos stehen still. Kein Weiterkommen. Endlich Ruhe, kein Jingle Bell, kein rieselnder Schnee. Der Motor ist abgestellt. Ich sitze ruhig am Steuer. Ein Verkehrskollaps kann erholsam sein: besinnlich und entspannend. Das Autoradio? Ich fürchte das Schlimmste. Ich rühre es nicht an.
Das Jahr in Bildern
JANUAR
1. Januar: Der erste Sonnenaufgang des Jahres

1. Januar: Stürmische Kampfansage

1. Januar: Amtsantritt eines Ultrarechten

14. Januar: Doppelt so viel Schnee wie üblich

19: Januar: Hexen im Schuss

21. Januar: Kurze Annäherung

21. Januar: „Super-Blutmond“

24. Januar: Umsturz-Versuch in Venezuela

31. Januar: Eiszeit


- FEBRUAR
2. Februar: Aufstand gegen Maduro

2. Februar: Versicherungssumme: 4 Milliarden


4. Februar: Vier Millionen leidende Kinder

6. Februar: „State of the Union Show“

8. Februar: Georg Gerster †


9. Februar: Prix de Lausanne: „Jeune espoir“

17. Februar: Aufstände gegen den serbischen Präsidenten

16. Februar: Bruno Ganz †

18. Februar: „Ach dieses Schlamassel!“

19. Februar: Karl Lagerfeld †


27. Februar: Abruptes Ende

- MÄRZ
6. März: Ladies in blue

8. März: Kein Kunstwerk

9. März: „La primera dama más linda“

10. März: Zweiter Absturz einer 737 Max 8

12. März: „Übermenschlich“

17. März: Entfesselte Gelbwesten

15. März: Terroranschläge in Christchurch

16. März: Petarden statt Fussball

23. März: „Remain!“

- APRIL
1. April: Überraschung in der Slowakei

4. April: Franz Weber †


6. April: „Es gibt keinen Planeten B“



12. April: „Foto des Jahres“

11. April: Assange festgenommen

15. April: Notre-Dame brennt




21. April: Machtwechsel in der Ukraine

21. April: Terror in Sri Lanka am Ostersonntag

28. April: Ein Sieg für nichts

30. April: Gescheiterter Putsch in Venezuela

- MAI
1. Mai: Seltsame königliche Sitten

4. Mai: Maduro hält sich

5. Mai: Rache für Rache

5. Mai: Bruchlandung in Moskau

9. Mai: Archie

11. Mai: Konfetti für einen Hoffnungsträger

16. Mai: Ueli Maurer im Oval Office

17. Mai: Ibiza-Gate

21. Mai: Arnold Hottinger †



27. Mai: Jubelnde Grüne

- JUNI
2. Juni: Nahles geht

3. Juni: Gut sieht er aus

9. Juni: Eine Million auf der Strasse

13. Juni: Eskalation im Golf von Oman

14. Juni: Stark befolgter Frauenstreik



16. Juni: Franco Zeffirelli †

18. Juni: Andrea Camilleri †

23. Juni: Schlag für Erdoğan


28. Juni: 4000 Tonnen gesprengt



- JULI
3. Juli: Die Unbeugsame

7. Juli: João Gilberto †

8. Juli: Sudanesischer Frühling?


15. Juli: Drei Jahre nach dem Putsch

16. Juli: Frau Kommissionspräsidentin

19. Juli: Eine Hymne an den Wein


21. Juli: Bahn frei für Selenski

21. Juli: Sommerwind

23. Juli: Prime Minister Boris

24. Juli: „Die Unwahrheit“

28. Juli: Ein Elefant blickt ins Tal

28. Juli: „Schämt euch!“



- AUGUST
8. August: Ziemlich selbstsicher

11. August: Oh, du schöne Ferienzeit

11. August: Sitzen verboten

16. August: Nicht zu verkaufen

16. August: Peter Fonda †


17. August: Gut sieht er aus, mit einen 79 Jahren

20. August: „Die Regierung endet hier“

21. August: Ines Torelli †

23. August: Ferner liefen

23. August: Relaxed

24. August: G7-Gipfel - wozu?


29. August: Conte bis

31. August: „Revolte“ in Moutier

- SEPTEMBER
1. September: Gewinne für die AfD

4. September: Take a break

5. September: Neues Team, neue Hoffnung


7. September: Russisch-ukrainischer Gefangenenaustausch

9. September: Robert Frank †

14. September: Trauernde Witwe

15. September: Scharzer Rauch über der saudischen Wüste

17. September: Patt

23. September: Das Jahr der Greta Thunberg

24. September: Schwerer Schlag für Boris

26. September: Jacques Chirac †

28. September: „Greta in den Nationalrat“


29. September: Sebastian Kurz triumphiert



- OKTOBER
5. Oktober: Schottland begehrt auf

5. Oktober: Kunst im Bahnhof

6. Oktober: Wo Sozialisten noch Wahlen gewinnen

8. Oktober: Physiknobelpreis an zwei Schweizer

9. Oktober: Rechtsextremer Terror



10. Oktober: Tokarczuk, Handke

11. Oktober: Ehre für Abiy Ahmed

14. Oktober: Ohrfeige für Orbán

20. Oktober: Grüne Flut

20. Oktober: Immer brutaler



23. Oktober: „Ich habe keine Luft mehr, ich sterbe“

23. Oktober: Hoffnungsträger in Tunesien

25. Oktober: Massenproteste in Libanon

27. Oktober: Das Ende des Kalifen

September/Oktober/November/Dezember: Troubles

27. Oktober: Rückkehr der Peronisten

- NOVEMBER
3. November: „Schamlose Gier“ der Machthaber

9. November: Lula ist frei


10. November: Abrupter Abgang

9. November: Aufgeheiztes Katalonien

10. November: Wieder Sánchez, wieder keine Mehrheit

10. November: Eine von zwölf

17. November: Erste Tessiner Ständerätin

November. Acqua Alta

24. November: Wieder stürzt eine Brücke ein

25. November: Bloomberg legt los

26. November: Köbi Kuhn †

November: Aufstände in Santiago

28. November: Trump als Rocky Balboa

30. November: Die SPD rückt nach links

- DEZEMBER
4. Dezember: „Der Vergewaltiger bist Du!“

10. Dezember: Die Jüngste

10. Dezember: Die Sardinen sind los

11. Dezember: Status quo



12. Dezember: „Let's get Brexit done, but first let's get breakfast done“

14. Dezember: Anna Karina †

22. Dezember: Fritz Künzli †

Zum Schluss noch dies

©journal21.ch/zusammengestellt von hh)
Jahresrückblick 2018
Jahresrückblick 2017
Jahresrückblick 2016

Jean-Paul Sartre
Weihnachten, ein Fest der Freude. Leider wird dabei zu wenig gelacht.
Der Flaschengeist und seine Zauberlehrlinge
„Permanent Record“, eben auf Deutsch erschienen als „Permanent Record: Meine Geschichte“, zeigt, dass sich die Welt aufteilt in eine kleine Digital-Elite und uns, den grossen Rest.
Die Enthüllungen des amerikanischen Geheimdienst-Mitarbeiters Edward Snowden Ende Mai 2013 in einem Hotelzimmer in Hong Kong erschütterten die Welt, nicht nur jene der CIA und ihrer mannigfaltigen Pendants in allen Teilen der Welt: Via digitale Übermittlungen, also unserem Computer und unserem Telefon, kann und wird potentiell jedermann ausspioniert, unbesehen von Staatsangehörigkeit, Rang, Namen, Verdachtsmomenten oder irgendeinem anderen primären Kriterium.
Snowden bewies dies, was die USA und ihre engsten nachrichtendienstlichen Verbündeten, namentlich Grossbritannien und Australien, anbelangt. Es ist praktisch mit Sicherheit anzunehmen, dass die grossen entsprechenden Rivalen, etwa China und Russland, dasselbe können und auch tun, wenn nicht schon damals, dann sicher seither.
Spannender Film
Snowdens Enthüllungen in Hong Kong machte er gleichzeitig gegenüber der Dokumentarfilmerin Laura Poitiras und gegenüber Journalisten der englischen Zeitung „The Guardian“. Der Film erhielt zurecht 2015 den Oscar für den besten Dokumentarfilm des Jahres. Trotz minimaler Handlung gelang es Poitiras mit nüchternen Bildern, sowohl die Glaubwürdigkeit des Erzählers als auch den erschütternden Inhalt seiner Geschichte der totalen Überwachung fesselnd zu erzählen. Dasselbe kann nicht gesagt werden von der entsprechenden romanesken Verfilmung 2016 durch Oliver Stone; „Snowden“ war, ebenso zurecht, ein Flop.
Wenig unterhaltendes Buch
Poitiras Film unterhält auch besser als Snowdens Buch. Seine Erzählung beschränkt sich weitgehend auf eine lineare, teilweise langfädige Darstellung seiner Jugendjahre, geprägt von digitaler Besessenheit seit zartem Alter. Sowie auf die minutiöse Darstellung seines beruflichen Werdeganges. Offensichtlich hat er sich aber stets nur für die digitale und geheimdienstliche Seite seiner Tätigkeit interessiert. Nicht aber für seine Umgebung. Wie wäre es sonst möglich, dass er während Jahre als Teil der Mission der USA bei den Vereinten Nationen in Genf kaum etwas über sein Umfeld zu sagen hat. Und wenn, unterlaufen ihm grobe Schnitzer. So platziert er den Hauptsitz der in Wien beheimateten IAEA (Internationale Atomenergie-Organisation) in die Rhonestadt.
Innere Wandlung
Interessant ist einmal die Beschreibung seines Werdeganges vom ehrlichen Patrioten, aufgebracht über den terroristischen Angriff auf die amerikanische Seele anlässlich von „Nine-Eleven“. Als Folge engagierte er sich in der Verteidigung der Heimaterde, zunächst mit einem Versuch als physischer Rambo. Und als dies wegen körperlichen Handicaps nicht gelang, indem er seine schon als Teenager erstaunlichen Kenntnisse der Digitalwelt der amerikanischen „Cyber-Wehr“ zur Verfügung stellte.
Allein wurde ihm immer bewusster, dass er damit Teil eines gigantischen Räderwerks wurde, das alles verschlang, nicht nur wirkliche, sondern auch vermeintliche „Feinde“ und überhaupt alle und alles. Wie und warum er den Weg von dieser Erkenntnis zur Tat – Notwendigkeit in seinen Augen und jener seiner Freunde, Landesverrat in jenen des offiziellen Amerikas und seiner Feinde – beschritt, zählt zu den interessantesten Passagen des Buchs. Er hat sich dabei offensichtlich stets vergegenwärtigt, dass er damit nicht nur seine beruflichen, sondern auch persönlichen Brücken zu seinem bisherigen Leben verbrannte. Immerhin ist einem neuen Interview mit dem „Guardian“ zu entnehmen, dass er seine langjährige Lebensgefährtin nun doch im russischen Exil heiraten konnte.
Snowden Effekt
Die Bedeutung von Snowdens Enthüllungen geht weit über seine Lebensgeschichte hinaus. Seither ist sich zumindest die denkende Weltbevölkerung bewusst, dass jeder digitale Kontakt bleibt, und sich letztlich der eigenen Verfügung entzieht. „Scripta manent“, Geschriebenes bleibt; digital Geschriebenes und Gesagtes bleibt nicht nur, sondern kann auch beliebig verwendet und auch verformt werden. Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass der „Snowden Effekt“ eine der Hauptursachen für Skepsis gegenüber dem Digitalbereich darstellt. Seither müssen wir uns bewusst sein, dass „the Net“, und alles danach ebenso gut wie böse sein kann.
Digital-Elite
Die wohl am meisten frappierende Erkenntnis aus Snowdens Buch ist aber eine, welche dem Autor selbst kaum bewusst sein dürfte: Wenn man nicht wie er bereit ist, von jüngstem Alter an sein ganzes Leben in den Dienst der digitalen Welt zu stellen, wird man dessen Hinter- und Abgründe kaum je wirklich verstehen können. So hat sich wohl bereits weltweit eine kleine Digital-Elite herausgebildet, deren Tätigkeit ebenso zur Errettung der Welt als auch zu deren Zerstörung beitragen kann. Es wird die Aufgabe von Politik und Gesellschaft sein, diesen Flaschengeist und seine Zauberlehrlinge zu zähmen, durchsichtig zu machen und zu kontrollieren.
Françoise Sagan
Man weiss selten, was Glück ist, aber man weiss meistens, was Glück war.
Vor 30 Jahren: 30 Schüsse
Anderthalb Monate nach dem Fall der Berliner Mauer geht in Rumänien die 24-jährige neostalinistische Ceaușescu-Periode zu Ende.
Am 22. Dezember 1989 hatten Zehntausende Rumäninnen und Rumänen versucht, das Parteigebäude in Bukarest zu stürmen. Ceaușescu und seine Frau flüchten. Mit einem Helikopter versuchen sie, aus der Hauptstadt zu entkommen.
In einem Pflanzenschutzzentrum im Norden Landes werden sie aufgegriffen. In einer Militärkaserne in der Stadt Târgoviște – der Stadt Draculas – wird ihnen am Weihnachtstag der Prozess gemacht. Doch es ist kein Prozess: es ist ein Verfahren ohne Verteidigung, ohne wirkliches Gericht. Die Ceaușescus weigern sich, das Gericht anzuerkennen. Nach 100 Prozessminuten fällt das Urteil: Tod durch Erschiessen.
Das rumnänische Fernsehen überträgt Ausschnitte des Schnellferfahrens. Dies ist das letzte Bild, das die beiden lebend zeigt.

Um 14.50 Uhr werden sie gefesselt in den Kasernenhof geführt. Unter Tränen ruft Ceaușescu: „Tod den Verrätern, die Geschichte rächt uns“. Dann singt er die Internationale. Drei Männer des 64. Fallschirmregiments feuern mit Kalaschnikow-Maschinengewehren dreissig Schuss auf die beiden.
Die Bilder der beiden toten Ceaușescus gehen um die Welt. Gefilmt werden die unscharfen, verwackelten Einstellungen von einem anonym gebliebenen Kameramann. Alles muss so schnell gehen, dass er nicht einmal Zeit hat, die Schärfe einzustellen. Das Erschiessungskommando fürchtet die baldige Ankunft der Securitate-Leute, die Ceaușescu retten wollen. Deshalb fackelt man nicht lange. Zehn Minuten nach dem Urteilsspruch sind die beiden tot.
Siehe auch: Journal21.ch: 30 Schüsse für Europas letzten Despoten
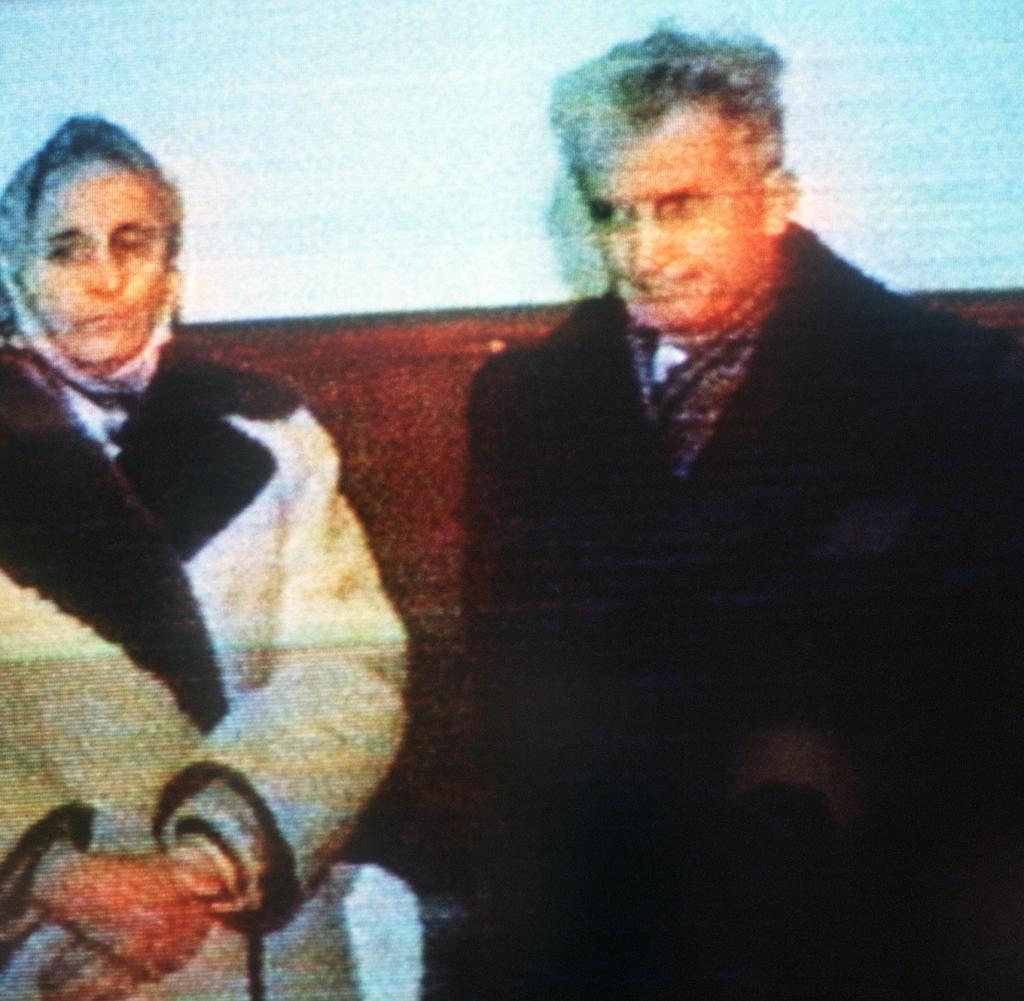
Eine Erhellung Lateinamerikas
„Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren“ heisst das umfangreiche Werk, das die 74-jährige deutsche Lektorin, Herausgeberin, Vermittlerin Michi Strausfeld verfasst hat. Sie, die vier Jahrzehnte lang für Suhrkamp und anschliessend noch ein paar Jahre für den Fischer Verlag lateinamerikanische Autorinnen und Autoren in die Programme hievte, präsentiert so etwas wie die Summe all der Reisen, Begegnungen, Gespräche, Entdeckungen, Lektorate, die sie in den letzten 50 Jahren unternommen, erlebt und bewältigt hat. Nimmt man sich das Buch vor, bekommt man es mit einer ganzen Bibliothek zu tun – die man nur noch wirklich lesen müsste. Strausfeld versammelt und zitiert zahllose Stimmen lateinamerikanischer Literaten und lässt einen mit dem Wunsch zurück, nachzuholen, was bisher verpasst wurde, Bildungslücken zu schliessen, all die Texte zu lesen, die man bis heute nicht wahrgenommen hat.
Plausible These
Strausfeld ist keine Wissenschafterin. Sie verficht eine These und liefert uns Beispiele en masse, um diese These zu stützen. Methodik, akademische Forschungen und Untersuchungen sind nicht ihre Sache. Sie erzählt vom und über das Erzählen, nimmt uns auf ihre Reisen mit und stellt uns die literarischen Protagonisten vor. Die an sich einfache Behauptung, die zu beweisen der Autorin nicht schwer fällt, besagt, dass sich die Geschichte des Subkontinents nirgends schärfer abbilde als in den verschiedenen lateinamerikanischen Literaturen, ja, dass sie sich in Romanen, Erzählungen, Essays und sogar Gedichten besser und deutlicher erkennen lasse als in historischen Abhandlungen. In dieser Hinsicht ist die hispanisch-lateinamerikanische Literatur einzigartig. Enger Bezug zu Politik und Geschichte: das ist der gemeinsame Nenner, der die Literaturen der einzelnen Länder verbindet. Vielleicht kommt Brasilien mit seiner anderen Sprache und anderen Kolonisation dabei eine Sonderrolle zu.
Man kann irgendwo anfangen mit lesen, in Argentinien oder Brasilien, in Chile oder Kolumbien, in Peru oder Mexiko, man wird feststellen, dass es so etwas wie ein länderverbindendes Bewusstsein gibt, das eben in diesem Interesse an der Geschichte des Subkontinents gründet Ein eigenes literarisches Genre wie der Diktatorenroman konnte nur in Lateinamerika entstehen; zur anderen populär gewordenen Genrebezeichnung, derjenigen des „magischen Realismus“, hat Gabriel García Márquez, dessen Romanen die europäischen Kritiker den Begriff angehängt haben, mehrmals verärgert geäussert, sein Realismus sei im Ganzen wie im Detail vor allem politisch.
Streifzüge
Strausfeld bearbeitet ihr riesiges Feld mit Hilfe von Streifzügen, die sie in verschiedene Zeiten und Regionen führen – ein sehr persönliches und eklektisches Verfahren, das spannende Resultate liefert. Freilich: es bleiben Tendenzen, es bleiben wichtige Autoren ausgespart bei diesem Verfahren, das ganz auf individuelle Vorlieben setzt. Strausfeld beschäftigt sich hauptsächlich mit den Autoren des sogenannten „Boom“, also mit Namen wie Juan Rulfo, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Julio Cortázar, Isabel Allende, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti und anderen mehr. Es sind die Autoren, die – häufig dank des Einsatzes von Michi Strausfeld – ab den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts die deutschsprachige Leserschaft eroberten. Eine einmalige Erfolgsgeschichte, Vernachlässigt wird, zum Beispiel, die fantastische Literatur Lateinamerikas, eine Spezialität, die Jorge Louis Borges initiiert und die viele Nachfolger beschäftigt hat. Sie passt nicht in Strausfelds These, bleibt aber eine wichtige Tendenz innerhalb der lateinamerikanischen Literatur.
Strausfelds Streifzüge fangen bei Kolumbus an, beschreiben die mörderische Kolonisation mit Kreuz und Schwert, dem ein grosser Teil der indigenen Bevölkerung zum Opfer fällt, wechseln dann zu den Unabhängigkeitskriegen, führen durch die mexikanische, die kubanische Revolution und enden in der Neuzeit, die, was die zitierten Autoren angeht, etwas stiefmütterlich behandelt wird.
Die Schriftsteller als Chronisten, als Zeugen, gelegentlich auch als Mitwirkende, in diplomatischen Diensten Stehende, das ist es, was Michi Strausfeld am meisten interessiert. Am Ende der einzelnen Streifzüge richtet sie den Fokus jeweils auf eine einzelne literarische Koryphäe, mit der sie in Kontakt tritt.
Ein Buch, wie gesagt, um das nicht herumkommen wird, wer sich auf eine Reise durch die Literaturen Lateinamerikas begibt. Michi Strausfeld ist eine kenntnisreiche, eine inspirierte und enthusiastische Reiseleiterin. Eine grosse Stilistin ist sie nicht. Kritische Auseinandersetzungen mit den zahlreichen erwähnten Autoren und Texten vermeidet sie. Was besprochen wird, landet im Superlativbereich, ist entweder grandios oder grossartig oder wunderbar. Eine berufsbedingte Sichtweise. Sie ermüdet zuweilen, wird einem aber letztlich das Vergnügen an dem überreichen Buch nicht verderben.
Michi Strausfeld: Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren, 568 Seiten, S. Fischer Verlag.
Federico Fellini
Gesichter sind die Lesebücher des Lebens.
Das Menetekel 737 Max
Kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, der Boeing-Konzernchef habe zurücktreten müssen. Seit dem Absturz einer 737 Max 8 der indonesischen Lion Air mit 189 Toten im Oktober 2018 spielt sich eine Grosskatastrophe in Zeitlupe ab. Ein halbes Jahr nach Lion Air traf es die Ethiopian Airlines, als eine ihrer fast fabrikneuen 737 Max 8 kurz nach dem Start in Addis Abeba abstürzte: 157 Tote. Was in der Folge portionenweise an die Öffentlichkeit drang, ist ein Drama systemischer Verantwortungslosigkeit.
Die 737-Serie fliegt seit 1967. Sie ist das weltweit am meisten eingesetzte Passagierflugzeug und wurde von Boeing immer wieder aufgepeppt. Jetzt aber ist ihr Lebenszyklus am Ende. Seit längerem kaufen Fluggesellschaften bevorzugt sparsamere und leisere Maschinen. Die 2016 auf dem Markt gekommene Airbus A 320neo befriedigt diese Kundenwünsche und setzt den amerikanischen Erzkonkurrenten unter Druck. In dieser Lage verzichtete Boeing auf die eigentlich geplante grundlegende Neukonstruktion eines Ersatzes für den Veteranen 737 und warf stattdessen ein weiteres Update auf den Markt, die 737 Max.
Damit die 737 Max den neuen Anforderungen genügen kann, hat sie einen neuen Typus von Triebwerken bekommen. Aus konstruktiven Gründen mussten diese so platziert werden, dass sie das Flugverhalten des Apparats ungünstig verändern. Dieser Nachteil wiederum sollte mit der eilig programmierten Software MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) korrigiert werden. Und dieses MCAS wiederum wurde in der Anleitung für Piloten nicht erwähnt, weil Boeing sonst teure Umschulungen hätte durchführen müssen.
Diese Kette unverantwortlicher unternehmerischer Entscheidungen hat nicht nur 346 Tote gefordert. Sie bringt auch einen der grössten Konzerne der USA an den Rand des Ruins. Zumindest beschädigt sie dessen Ruf auf Jahrzehnte und bringt ausserdem die mitverantwortliche US-Luftfahrtbehörde FAA in die Bredouille.
Und wie reagieren die Verantwortlichen? Sie vertuschen, so lange es geht. Sie versuchen mit Aktienrückkäufen und überrissenen Devisenausschüttungen die Aktionäre bei der Stange zu halten. Erst mit langer Verzögerung hat der CEO den Hut nehmen müssen. Ersetzt wird er durch den genauso involvierten Verwaltungsratspräsidenten. Und der Boss der FAA, der wichtige Teile der Zulassungsprüfung für die 737 Max an den Hersteller ausgelagert hat, rechtfertigt sich dafür mit Kosten- und Zeiteinsparungen.
Das vorrangige Drücken der Kosten sowie die alleinige Ausrichtung auf kurzfristige Gewinnmaximierung haben einen hohen Preis. Fast vierhundert Flugzeuge bei rund siebzig Airlines sind seit März gegroundet, weitere über vierhundert fabrikneue Maschinen stehen bei Boeing auf Halde, Bestellungen werden in grossem Umfang storniert, neue Orders bleiben aus, das wichtigste Produkt von Boeing ist praktisch tot, es drohen Schadenersatzforderungen in gigantischer Höhe, der Ruf des Herstellers ist genauso gründlich zerstört wie derjenige der FAA. Wahrhaftig ein schmerzhaftes Lehrstück. Doch ob daraus auch gelernt wird?
Taiwans heikle Lage
Die seit 2016 amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen nominierte im November ihren Vize für die Präsidentschaftswahlen am 11. Januar. Sie entschied sich für den ehemaligen Premierminister William Lai, der offen für die Unabhängigkeit Taiwans eintritt. Kurz darauf kreuzte durch die 160 Kilometer breite Formosa-Strasse – heute meist Taiwan-Strasse genannt – der zweite, eben fertiggestellte chinesische Flugzeugträger. Zu ausschliesslich technischen Testzwecken, wie Peking offiziell verlauten liess. In Taiwan – und in den USA – allerdings wurde der chinesische Test ganz anders interpretiert als Einmischung in die taiwanesischen Wahlen. Taiwans Aussenminister Joseph Wu: „Die Wähler lassen sich nicht einschüchtern“.
Präsidentin Tsai tritt für eine zweite Amtsperiode für die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) an, eine Partei, die mit ihrer unabhängigkeitsnahen Haltung China immer wieder provoziert. Tsais Wahlslogans widerspiegeln diese Richtung. „Widersetze dich China, verteidige Taiwan“, heisst es etwa oder „Das heutige Hong Kong könnte das morgige Taiwan sein“.
Präsidentin abgestraft
Im vergangenen Januar noch sah es düster aus für die Wiederwahl der amtierenden Präsidentin. Ihre Partei DPP hatte eben die Lokal- und Regionalwahlen 2018 haushoch verloren. Tsai wurde regelrecht abgestraft. Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete sie laut repräsentativen Umfragen gerade noch die Zustimmung von 35 Prozent der Taiwanesinnen und Taiwanesen, nachdem sie bei Amtsantritt noch eine bemerkenswert hohe Unterstützungsquote von über 70 Prozent erzielt hatte.
Die nationalistische Kuomintang-Partei (KMT) war die grosse Siegerin der Lokal- und Regionalwahlen, allen voran Han Kuo-yu. Er ist ein Meister in der politischen Verwendung der sozialen Medien, was in Taiwan wegen der weit fortgeschrittenen Digitalisierung besonders wichtig ist. So verwenden 24 Millionen Taiwanesen 29 Millionen mobile Telephone. 21 Millionen benutzen das Internet und die sozialen Medien. Immerhin noch 30 Prozent der Bevölkerung tummeln sich sogar auf dem chinesischen WeChat. Kein Wunder deshalb, dass die DPP von „täglichen“ chinesischen Cyberattacken schwadroniert, allerdings ohne auch nur die kleinsten Indizien oder Beweise.
Lokalpolitiker Han in der Populisten-Schublade
Der rührige Lokalpolitiker Han Kuo-yu profitierte von seinen professionell ausgeführten Social-Media-Kampagnen. Er wurde in der DPP-Hochburg Kaoshiung, einer wichtigen, direkt der Regierung unterstellten Hafenstadt im Süden, zum Bürgermeister gewählt. Nach Hans Ansicht sind die Wahlen vom 11. Januar 2020 eine Wahl „zwischen Friede und Krise mit China“. „Präsidentin Tsai“, so Han, „ist unfähig, das Land zu regieren; deshalb ist die Republik China in einem Sturm und die Beziehungen über die Taiwan-Strasse sind turbulent“.
Han Kuo-yus Wahlslogan: „Ein sicheres Taiwan – Wohlhabende Leute“. Westliche Medien steckten Han also gleich in die Populisten-Schublade. Wohl etwas zu früh, denn Han ist weder nationalistisch-chauvinistisch noch rechtsextrem oder ausländerfeindlich. Auch lügt er nicht so gedruckt wie der mächtige Taiwan-Protektor und Waffenlieferant Donald Trump, sondern nur so, wie das eben bei Politikern weltweit üblich ist.
In zwei Punkten freilich stimmen sowohl die beiden Präsidentschaftskandidaten überein. Beide sind gegen das chinesische Wiedervereinigungsprinzip „Ein Land, Zwei Systeme“. Dieses Prinzip hatte einst der grosse Revolutionär und Reformer Deng Xiaoping für Hong Kong, Macau und eben Taiwan erdacht. Han verspricht seinen Wählern, dass dieses Prinzip nur „über meinen toten Körper“ eingeführt werden könne.
Beispiel Hong Kong
Sowohl Tsai als auch Han können sich bei diesem Punkt auf die Meinung des Volkes abstützen. Bei einer repräsentativen Umfrage anfangs Dezember sprachen sich 89,3 Prozent der Bevölkerung gegen das Prinzip „Ein Land, Zwei Systeme“ aus, elf Monate zuvor waren es 75,4 Prozent. Auch was Hong Kong betrifft, sind sich Han und Tsai einig. Sie unterstützen die „Demokratiebewegung“. Allerdings ist ähnlich wie im Westen die Berichterstattung über die Hongkonger Ereignis in Taiwan einseitig und voreingenommen.
Han Kuo-yu lag – obwohl erst seit dem 15. Juli offiziell Präsidentschaftskandidat – im Rennen um die Wählergunst noch im März weit vor Tsai, selbst nach seiner Reise nach China, Hong Kong und Macau. In Peking bekräftige Han den „Konsensus 1992“, wonach Peking und Taipeh an einem einzigen China festhalten. Allerdings wurde Han nach dieser Reise zu viel Nähe zu China vorgeworfen.
Androhung militärischer Gewalt durch Xi
Präsidentin Tsai Ing-wen begann jedoch bereits seit Januar die Gunst der Wähler langsam zurückzuerobern. Anlass war eine Rede des chinesischen Staats-, Partei- und Militärchefs Xi Jinping. Taiwan, so Xi, werde früher oder später wieder zum „Vaterland“ zurückkehren, das sei historisch so vorgesehen. Xi brauchte starke, klare Worte: „Wir können nicht versprechen, dass wir auf den Einsatz von Gewalt verzichten. Wir behalten uns diese Option vor, im Zweifel alle nötigen Massnahmen zu ergreifen. Dieser Hinweis richtet sich nicht gegen unsere Landsleute in Taiwan, sondern an Kräfte von ausserhalb und an die sehr geringe Zahl von Unabhängigkeitsaktivisten in Taiwan.“ Den militärischen, aber auch den ökonomischen und diplomatischen Druck erhält Peking zur Erreichung des historischen Ziels der Wiedervereinigung bis heute aufrecht.
„Historisch so vorgesehen“ – Parteichef Xi hat nicht Unrecht. Mitte des 16. Jahrhunderts tauchten die damals mächtigen portugiesischen Seefahrer vor Taiwan auf und nannten die Insel Formosa, die von wenigen polynesischen Urbewohnern und wenigen Han-Chinesen besiedelt war. Danach besetzten am Anfang des 17. Jahrhunderts die Holländer die Insel als fernöstliche Handelsstation. Nach dem Ende der Ming-Dynastie 1644 flüchteten viele Ming-Loyalisten nach Taiwan. Der berühmte Qin-Kaiser Kangxi annektierte 1683 die Insel. Nach dem Sino-japanischen Krieg 1894/95 wurde Taiwan durch den Vertrag von Shimonoseki bis zum Ende des II. Weltkrieges 1945 eine japanische Kolonie.
Historischer Bestandteil Chinas
Nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten (1945-49) flüchteten rund zwei Millionen Chinesen, angeführt von Kuomintang-Generalissimo Chiang Kai-shek, auf das nahe gelegene Eiland. Chiang nannte Taiwan Republik China und beanspruchte die Herrschaft über ganz China. Bis 1987 stand Taiwan unter Kriegsrecht und wurde mit harter diktatorischer Hand regiert. Chiangs Sohn Chiang Ching-kuo initiierte erste Reformen des politischen Systems, welche in ersten allgemeinen Wahlen 1996 mündeten. Seither wechseln sich im Acht-Jahre Rhythmus die Demokratische Fortschrittspartei DPP und die nationalistische Kuomintang-Partei KMT in der Machtausübung ab.
In China selbst wurde und wird Taiwan stets als abtrünnige Provinz bezeichnet. Selbst für jene Chinesen und Chinesinnen, die mit der allmächtigen KP Chinas sonst nicht einverstanden sind, ist klar, das Taiwan ein untrennbarer Bestandteil Chinas ist. Peking ist seit Jahren bestrebt, Taiwan als unabhängigen Staat international zu isolieren. Bereits 1971 nahm China in der Uno den Platz anstelle von Taiwan ein. 1979 wechselten die USA die diplomatische Seite von Taipeh nach Peking, blieben aber im Hintergrund bis auf den heutigen Tag Verbündeter Taiwans und vor allem als Waffenlieferant.
Von 193 Uno-Staaten pflegen heute nur noch 14 kleine Länder, darunter der Vatikan, mit Taipeh diplomatische Beziehungen. Auch in den meisten internationalen Organisationen ist Taiwan nicht willkommen. Unter dem Namen „Chinese Taipei“ darf Taiwan zum Beispiel an den Olympischen Spielen teilnehmen. Unter gleichem Namen ist Taiwan Mitglied der Welthandels-Organisation WTO und der Asiatischen Entwicklungsbank ADB sowie Beobachter bei der Weltgesundheits-Organisation WHO.
Taiwanesisches Wirtschaftswunder
Wirtschaftlich gedieh Taiwan bereits unter der Diktatur Generalissimo Chiangs prächtig. In den 1960er und 1970er Jahren boomte die Volkswirtschaft, man sprach vom taiwanesischen Wirtschaftswunder. Singapur, Südkorea, Hong Kong und Taiwan gingen als die „Vier Asiatischen Tiger“ in die neueste Wirtschaftsgeschichte ein. Heute steht Taiwan weltweit auf Rang 21 der grössten Volkswirtschaften und gar auf Rang 15 beim pro-Kopf-Einkommen des Brutto-Inlandprodukts. China ist mit 40 Prozent aller Exporte mit Abstand der grösste Handelspartner, wobei Taiwan einen Handelsbilanzüberschuss von 80 Milliarden Dollar erzielt.
Eine Million Taiwanesinnen und Taiwanesen leben und arbeiten auf dem Festland. Investoren von der Insel sind mit weit über 100 Milliarden Dollar auf dem Festland engagiert. Hunderttausende von Touristen vom Festland besuchen jährlich die abtrünnige Provinz. In den letzten zwei Jahrzehnten sind – meist unter einem Kuomintang-Präsidenten – direkte Flug-, See und Postverbindungen über die Strasse von Formosa eingerichtet geworden, wo vorher lange Umwege nötig waren. Vom Cyberspace ganz zu schweigen.
Schlägt das Analoge das Digitale?
Wer wird am 11. Januar siegreich aus den Wahlen hervorgehen? Wird Hong Kong und China entscheidend sein oder eher Innenpolitik? Nach einer Umfrage der Zeitung „United Daily News“ sind die Wählerinnen und Wähler von der innenpolitischen Leistung von Präsidentin Tsai schwer enttäuscht. Gerade einmal 23 Prozent der Bevölkerung sind der Ansicht, dass sich seit Amtsantritt von Tsai 2016 die Lage verbessert hat. Dennoch, die neuesten Wahlumfragen zeigen ein Plus für Tsai Ying-wen. 35 bis 50 Prozent werden sich demnach für die amtierende Amtsinhaberin aussprechen. Herausforderer Han Kuo-yu kommt lediglich auf 15 bis 30 Prozent.
Doch Achtung: Cyberspace! Wird es der digitale Zauberlehrling Han am Schluss noch richten und die vor allem analog kämpfende Tsai besiegen?